Suche
Suche
Alle Kategorien
News
Alle Kategorien
Corona
26.01.2026
Auswirkungen der Kormoranprädation auf die Fischerei und Aquakultur in der EU
Aktuelle Übersicht zur Kormoranprädation in der EU
Briefing vom 20.01.2026
Der Kormoran hat erhebliche und weitreichende Auswirkungen auf Fischbestände und Aquakulturanlagen. Aufgrund seiner Prädationstätigkeit wurde der Kormoran im 19. und frühen 20. Jahrhundert stark verfolgt, steht aber seit Inkrafttreten der EU-Vogelschutzrichtlinie im Jahr 1979 unter Schutz. Seine Population hat sich seitdem deutlich erholt. Obwohl die Jagd auf den Vogel verboten ist, erlaubt die Vogelschutzrichtlinie Ausnahmeregelungen, um schwere Schäden an Wildfischbeständen und Fischzuchten zu verhindern. Diese Ausnahmeregelungen werden von den Mitgliedstaaten in sehr unterschiedlicher Weise genutzt.
Das Europäische Parlament forderte 2008 die Annahme eines europäischen Kormoranmanagementplans, um die zunehmenden Auswirkungen der Kormorane auf Fischbestände, Fischerei und Aquakultur zu minimieren. Diese Forderung wurde in den Entschließungen des Parlaments zur Aquakultur von 2018 und 2022 bekräftigt. Auch auf den Ratssitzungen im September und Oktober 2025 forderten mehrere Mitgliedstaaten die Europäische Kommission nachdrücklich auf, das EU-weite Management der Kormoranpopulationen zu koordinieren.
Im Anschluss an die jüngsten Gespräche führte die Kommission im Oktober 2025 einen strukturierten Dialog mit den Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang veröffentlichte die Kommission aktualisierte Leitlinien zur Anwendung von Ausnahmeregelungen gemäß der Vogelschutzrichtlinie. Im November 2025 veröffentlichte die Europäische Binnenfischerei- und Aquakultur-Beratungskommission, ein zwischenstaatliches Beratungsgremium für Fischereifragen, ihren endgültigen Rahmen für einen Managementplan im Rahmen eines von der EU kofinanzierten Projekts.
Ziel dieser Initiative ist es, den günstigen Erhaltungszustand des Kormorans zu erhalten und gleichzeitig Fischarten und Aquakulturanlagen zu schützen.
Hierzu ist nun ein umfagnreicher „Briefing“-Artikel in Englischer Sprache erschienen.
(„Briefing“-Artikel bieten forschungsbasierte Handlungsempfehlungen zu drängenden wirtschaftlichen Herausforderungen und sind in einer für Laien verständlichen Sprache verfasst. Sie sollen so kurz wie möglich sein, aber dennoch ausreichend ausführlich, um ein politisches Problem eingehend zu beleuchten)
Der Kormoran hat erhebliche und weitreichende Auswirkungen auf Fischbestände und Aquakulturanlagen. Aufgrund seiner Prädationstätigkeit wurde der Kormoran im 19. und frühen 20. Jahrhundert stark verfolgt, steht aber seit Inkrafttreten der EU-Vogelschutzrichtlinie im Jahr 1979 unter Schutz. Seine Population hat sich seitdem deutlich erholt. Obwohl die Jagd auf den Vogel verboten ist, erlaubt die Vogelschutzrichtlinie Ausnahmeregelungen, um schwere Schäden an Wildfischbeständen und Fischzuchten zu verhindern. Diese Ausnahmeregelungen werden von den Mitgliedstaaten in sehr unterschiedlicher Weise genutzt.
Das Europäische Parlament forderte 2008 die Annahme eines europäischen Kormoranmanagementplans, um die zunehmenden Auswirkungen der Kormorane auf Fischbestände, Fischerei und Aquakultur zu minimieren. Diese Forderung wurde in den Entschließungen des Parlaments zur Aquakultur von 2018 und 2022 bekräftigt. Auch auf den Ratssitzungen im September und Oktober 2025 forderten mehrere Mitgliedstaaten die Europäische Kommission nachdrücklich auf, das EU-weite Management der Kormoranpopulationen zu koordinieren.
Im Anschluss an die jüngsten Gespräche führte die Kommission im Oktober 2025 einen strukturierten Dialog mit den Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang veröffentlichte die Kommission aktualisierte Leitlinien zur Anwendung von Ausnahmeregelungen gemäß der Vogelschutzrichtlinie. Im November 2025 veröffentlichte die Europäische Binnenfischerei- und Aquakultur-Beratungskommission, ein zwischenstaatliches Beratungsgremium für Fischereifragen, ihren endgültigen Rahmen für einen Managementplan im Rahmen eines von der EU kofinanzierten Projekts.
Ziel dieser Initiative ist es, den günstigen Erhaltungszustand des Kormorans zu erhalten und gleichzeitig Fischarten und Aquakulturanlagen zu schützen.
Hierzu ist nun ein umfagnreicher „Briefing“-Artikel in Englischer Sprache erschienen.
(„Briefing“-Artikel bieten forschungsbasierte Handlungsempfehlungen zu drängenden wirtschaftlichen Herausforderungen und sind in einer für Laien verständlichen Sprache verfasst. Sie sollen so kurz wie möglich sein, aber dennoch ausreichend ausführlich, um ein politisches Problem eingehend zu beleuchten)
18.01.2026
Berliner Agrarministerkonferenz 2026: Ein Ort für Brücken, nicht für Gräben
Ministerinnen und Minister aus rund 60 Staaten wollen effizientere Wassernutzung in der Landwirtschaft fördern
Unter Vorsitz des Bundesministers für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Alois Rainer, fand heute die 18. Berliner Agrarministerkonferenz mit Agrarministerinnen und Agrarministern aus 61 Staaten sowie Vertreterinnen und Vertretern von 14 internationalen Organisationen statt. In ihrer Abschlusserklärung betonten die Ministerinnen und Minister, dass die Landwirtschaft auf ausreichend Wasser angewiesen ist, um Lebensmittel zu produzieren. Landwirtschaft spielt damit eine Schlüsselrolle für die globale Ernährungssicherheit. Zugleich machten die Agrarminister deutlich, dass die Landwirtschaft als einer der größten Wassernutzer ein zentraler Teil der Lösung bei der Bewältigung von Wasserknappheit ist. Sie kann entscheidend zu einer nachhaltigen Wassernutzung beitragen und wirksame Lösungen für eine globale Wasserresilienz liefern.
Dazu sagt Bundesminister Rainer: „Wasser entscheidet über Ernten, Ernten entscheiden über Ernährung und eine gesicherte Ernährung entscheidet über unsere Zukunft. Uns Agrarministerinnen und Agrarminister eint ein Auftrag: die Produktivität der Land- und Ernährungswirtschaft zu stärken, Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und damit die Einkommen der Höfe zu stabilisieren. Und dabei ist klar: Landwirtschaft braucht Wasser.
Ich freue mich, dass heute von Berlin das klare Bekenntnis ausgeht, dass die Landwirtschaft nicht das Problem, sondern ein zentraler Teil der Lösung für eine nachhaltige Wassernutzung ist. Darauf haben wir uns in unserer Abschlusserklärung verständigt. Diese Abschlusserklärung ist der Ausdruck unseres gemeinsamen Willens, Verantwortung zu übernehmen. Wir bekennen uns dazu, eine effizientere Wassernutzung in der Landwirtschaft zu fördern, etwa durch präzise Bewässerung, Wassereinsparung, besseren Bodenschutz und die Reduzierung von Lebensmittelverlusten. Das zeigt, dass die Agrarministerkonferenz ein Ort für Brücken ist, nicht für Gräben.“
Ich freue mich, dass heute von Berlin das klare Bekenntnis ausgeht, dass die Landwirtschaft nicht das Problem, sondern ein zentraler Teil der Lösung für eine nachhaltige Wassernutzung ist. Darauf haben wir uns in unserer Abschlusserklärung verständigt. Diese Abschlusserklärung ist der Ausdruck unseres gemeinsamen Willens, Verantwortung zu übernehmen. Wir bekennen uns dazu, eine effizientere Wassernutzung in der Landwirtschaft zu fördern, etwa durch präzise Bewässerung, Wassereinsparung, besseren Bodenschutz und die Reduzierung von Lebensmittelverlusten. Das zeigt, dass die Agrarministerkonferenz ein Ort für Brücken ist, nicht für Gräben.“
Die Ministerinnen und Minister haben zudem gefordert, die Stimme der Landwirtschaft im Vorfeld der UN-Wasserkonferenz 2026 zu stärken und den Sektor in der globalen Wasserpolitik einzubeziehen.
Die wichtigsten Punkte der Abschlusserklärung für die Fischerei sind:
2. Wir unterstreichen, dass Wasser für alles Leben auf der Erde, für unsere Volkswirtschaften und für unsere Ernährungssysteme unverzichtbar ist. Unsere Landwirtinnen und Landwirte und Fischerinnen und Fischer sind auf Wasser angewiesen, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Wasserstress ist jedoch eine der größten Bedrohungen des 21. Jahrhunderts, unter der mehr als zwei Milliarden Menschen leiden. … Landwirtschaft, Fischerei und Aquakultur sind weltweit stark von wachsender Wassernutzungskonkurrenz betroffen, was es immer schwieriger macht, ihre Rolle bei der Gewährleistung von Ernährungssicherheit und -qualität und der schrittweisen Verwirklichung des Rechts auf angemessene Nahrung zu erfüllen. …
Blaue Bioökonomie stärken
13. In Übereinstimmung mit dem GFFA-Kommuniqué 2025 zur Bioökonomie betonen wir die zentrale Rolle einer nachhaltigen blauen Bioökonomie für alle Branchen und Sektoren, die mit Ozeanen, Meeren, Küsten und Seen und ihren lebenden Ressourcen in Verbindung stehen. Wir erkennen darüber hinaus das Potenzial der blauen Bioökonomie an, die Ernährungssicherheit zu steigern und gleichzeitig die Einkommensdiversifizierung für lokale Gemeinschaften in küstennahen und ländlichen Gebieten zu stärken und traditionelles Wissen zu schützen. Wir verpflichten uns zu einer effektiven Erhaltung, Bewirtschaftung, Wiederherstellung und nachhaltigen Nutzung von lebenden aquatischen Ressourcen und Wasser. Dazu gehört die Förderung nachhaltiger Fischerei und Aquakultur sowie die Verbesserung der Nutzbarmachung, Verarbeitung und Wertschöpfung von Produkten aus aquatischen Ressourcen im Einklang mit den FAO-Leitlinien für nachhaltige Aquakultur.
16. Wir sehen die Notwendigkeit, Innovationen, Entwicklung und inklusive Marktintegration in Bezug auf nachhaltig produzierte aquatische Biomasse, insbesondere vielversprechende, jedoch derzeit unzureichend genutzte Ressourcen wie Algen und Restrohstoffe aus Fischerei und Aquakultur, zu unterstützen. Wir heben die Notwendigkeit hervor, soziales Bewusstsein und Akzeptanz von neuen Produkten der blauen Bioökonomie zu steigern.
20. Wir erkennen an, dass der Zugang zu Wasser für die Nahrungsmittelproduktion von zentraler Bedeutung ist. Wir nehmen Kenntnis vom „Globalen Dialog zu Nutzungs- und Besitzrechten an Wasser“5 der FAO, der alle FAO-Mitglieder ermutigt, sich der politischen Initiative anzuschließen, um einen kontextspezifischen, gleichberechtigten, zeitgerechten und sicheren Zugang zu Wasserressourcen zu unterstützen.
Internationale Wasser Governance stärken
22. Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordination bei Wasser bei gleichzeitiger Achtung der nationalen Souveränität ist entscheidend für eine effektive Bekämpfung von Wasserstress. Daher sind wir bestrebt, zu größerer Bewusstheit, Kohärenz und Effektivität der Wasser Governance im VN-System und darüber hinaus beizutragen. Damit werden wir die Stimme der Landwirtschaft, der Fischerei und der Aquakultur bei wasserpolitischen Entscheidungen stärken. Wir unterstreichen, dass diese zentralen Akteure Fachwissen einbringen und den Weg zu globalen Lösungen weisen.
28. Angesichts der dringenden Notwendigkeit, Wassersicherheit und Wasserresilienz zu steigern, und im Vorfeld der VN-Wasserkonferenz 2026 und darüber hinaus rufen wir die internationale Gemeinschaft auf:
- die Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur als zentrale Sektoren in die Entscheidungsfindung innerhalb der Wasserpolitik einzubinden; …
20.12.2025
EU-Fischmarktbericht 2025 veröffentlicht
Die Europäische Marktbeobachtungsstelle für Fischerei (EUMOFA) hat die 2025 Ausgabe des EU-Fischmarktberichts veröffentlicht, der die neuesten Trends im europäischen Fischerei- und Aquakulturmarkt aufzeigt. Basierend auf Daten bis Anfang 2025 belegt der Bericht, dass der Markt volatilen Preisen, dynamischen globalen Angebotsbedingungen und einem sich wandelnden Verbraucherverhalten ausgesetzt war.
15.12.2025
Umsetzung der EU Kontroll-VO zur Rückverfolgbarkeit von Fisch und Fischerzeugnissen
Europäischer Gesetzgeber definiert Basisstandard und schafft Rechtssicherheit für die Unternehmen
Die überarbeitete europäische Fischereikontrollverordnung bringt ab dem 10.01.2026 neue gesetzliche Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit von Fischerei und Aquakulturerzeugnissen (für frische, gefrorene und geräucherte Produkte) in der Union. Bisher wurden wichtige Grundlagen zur praktischen Umsetzung dieser Vorgaben vom europäischen Gesetzgeber nicht geregelt. Nach wiederholter Eingabe des Bundesverbandes und der europäischen Partnerverbände hat die Europäische Kommission gestern wichtige Eckpunkte erläutert. Damit wird größerer Schaden abgewendet und Rechtssicherheit für die Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette vom Erzeuger bis zum Handel geschaffen.
Die Unternehmen erhalten die Entwarnung, dass sie ihre bisherigen Verfahren zur Rückverfolgbarkeit nicht fundamental umstellen müssen.
Auch der VDBA begrüßt diese Klarstellung zur Umsetzung der geänderten Fischereikontrollverordnung.
Der Bundesverband der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V. fasst dies in seiner PM wie folgt zusammen:
Informationsschreiben EU-KOM im englischen Original als PDF
Dr. Stefan Meyer, Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V., hat die Entwicklungen dieses Regelwerks in Berlin und Brüssel intensiv begleitet und merkt hierzu an: „Mit dem Informationsblatt wird das Grundprinzip der Rückverfolgbarkeit – die Eigenverantwortung der Unternehmen auf ihrer jeweiligen Stufe der Lieferkette – klar gestärkt. Die nun vorliegenden Klarstellungen schaffen Rechtssicherheit für die Betriebe und geben ihnen die notwendige Orientierung, um die Vorgaben sachgerecht und praxistauglich umzusetzen.“
Die Unternehmen erhalten die Entwarnung, dass sie ihre bisherigen Verfahren zur Rückverfolgbarkeit nicht fundamental umstellen müssen.
Auch der VDBA begrüßt diese Klarstellung zur Umsetzung der geänderten Fischereikontrollverordnung.
Der Bundesverband der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V. fasst dies in seiner PM wie folgt zusammen:
- Losfassung beginnt am Ursprung: Die Losbildung beginnt im Ursprung, d. h. bei Fischerei und Aquakultur. Damit sind Herkunft und erste Zusammenstellung der Ware miteinander verbunden und bleiben durchgängig nachvollziehbar. Auf Grundlage dieser Informationen können die nachfolgenden Lieferkettenpartner Lose nach ihren Bedürfnissen teilen, mischen und zusammenfassen. Die grundlegenden Losinformationen bleiben davon unberührt.
- Flexible digitale Formate: Die digitale Bereitstellung der Losinformationen kann in verschiedenen gängigen Formaten erfolgen – zum Beispiel per E-Mail, als elektronische Dateien (wie PDF, XML oder CSV), über Online-Plattformen oder jedes andere elektronische System, das in der Lage ist, Informationen auf digitale, papierlose Weise zu übermitteln. Unternehmen wählen das für ihren Betrieb praktikable Format, solange die Mindestangaben vollständig und nachvollziehbar übermittelt werden. Damit können auch bereits etablierte Dokumentenformate, z. B. Lieferscheine, die Vorgaben erfüllen, wenn sie auf digitalem Weg übermittelt werden und die entsprechenden Losinformationen enthalten.
- „Ein Schritt vor, ein Schritt zurück“: Die Informationen werden entlang der Lieferkette von Glied zu Glied weitergegeben. Eine übergeordnete Weitergabe, branchenweite Interoperabilitätspflichten oder die verbindliche Nutzung von Drittanbieter Lösungen zur Rückverfolgbarkeit sind nicht gefordert. Entscheidend ist die sichere Übermittlung der Daten an den jeweiligen direkten Geschäftspartner und, auf Verlangen an die zuständige Behörde.
Informationsschreiben EU-KOM im englischen Original als PDF
Dr. Stefan Meyer, Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V., hat die Entwicklungen dieses Regelwerks in Berlin und Brüssel intensiv begleitet und merkt hierzu an: „Mit dem Informationsblatt wird das Grundprinzip der Rückverfolgbarkeit – die Eigenverantwortung der Unternehmen auf ihrer jeweiligen Stufe der Lieferkette – klar gestärkt. Die nun vorliegenden Klarstellungen schaffen Rechtssicherheit für die Betriebe und geben ihnen die notwendige Orientierung, um die Vorgaben sachgerecht und praxistauglich umzusetzen.“
28.11.2025
Young Fisherman erhält FEAP–Laschinger NextGen Award bei FEAP-Generalversammlung in München
VDBA richtet FEAP-Generalversammlung aus
Die FEAP-Generalversammlung ist das jährliche Treffen des Verbandes europäischer Aquakulturproduzenten. Dieses Jahr fand sie am 27. & 28. November in München, organisiert vom VDBA mit freundlicher Unterstützung von trouw nutrition, statt.
Das Highlight des zweitägigen Meetings war die erstmalige Vergabe des FEAP–Laschinger NextGen Awards.
Der VDBA ist besonders stolz, dass als erster Preisträger ein leuchtender Stern unserer Young Fishermen von der internationalen Jury einstimmig ausgewählt wurde!
Die moderne Indoor-Zuchtanlage von Josef Stier in Bärnau verfügt über eigene Tiefbrunnen, einen mit Hackschnitzel befeuerten Holzvergaser, ein Blockheizkraftwerk und eine Photovoltaik-Anlage. Diese Kombination macht es möglich, eine nachhaltige und kosteneffiziente Produktion von Zander, Aalen, Regenbogenforellen, Bachforellen, Lachsforellen und sogar Garnelen sicherzustellen. Weil das Wasser in den Kreislaufanlagen kontinuierlich mechanisch und biologisch gereinigt sowie mit UV-Licht behandelt wird, ist auch der Wasserverbrauch extrem niedrig. Im Rahmen eines Forschungsprojekts mit der Landesanstalt für Landwirtschaft wird in einer modernen robotergestützten Anlage zusätzlich eigenes, hochwertiges und proteinreiches Fischfutter in Kreislaufproduktion aus organischen Abfällen für schwarze Soldatenfliegen produziert.
Dieses innovative, ganzheitliche Konzept ist ein Leuchtturm-Beispiel für nachhaltige und verantwortungsvolle Lebensmittelproduktion und verdient die Anerkennung durch den FEAP–Laschinger NextGen Award.
Wir gratulieren Josef Stier ganz herzlich zu dieser wohlverdienten Anerkennung!
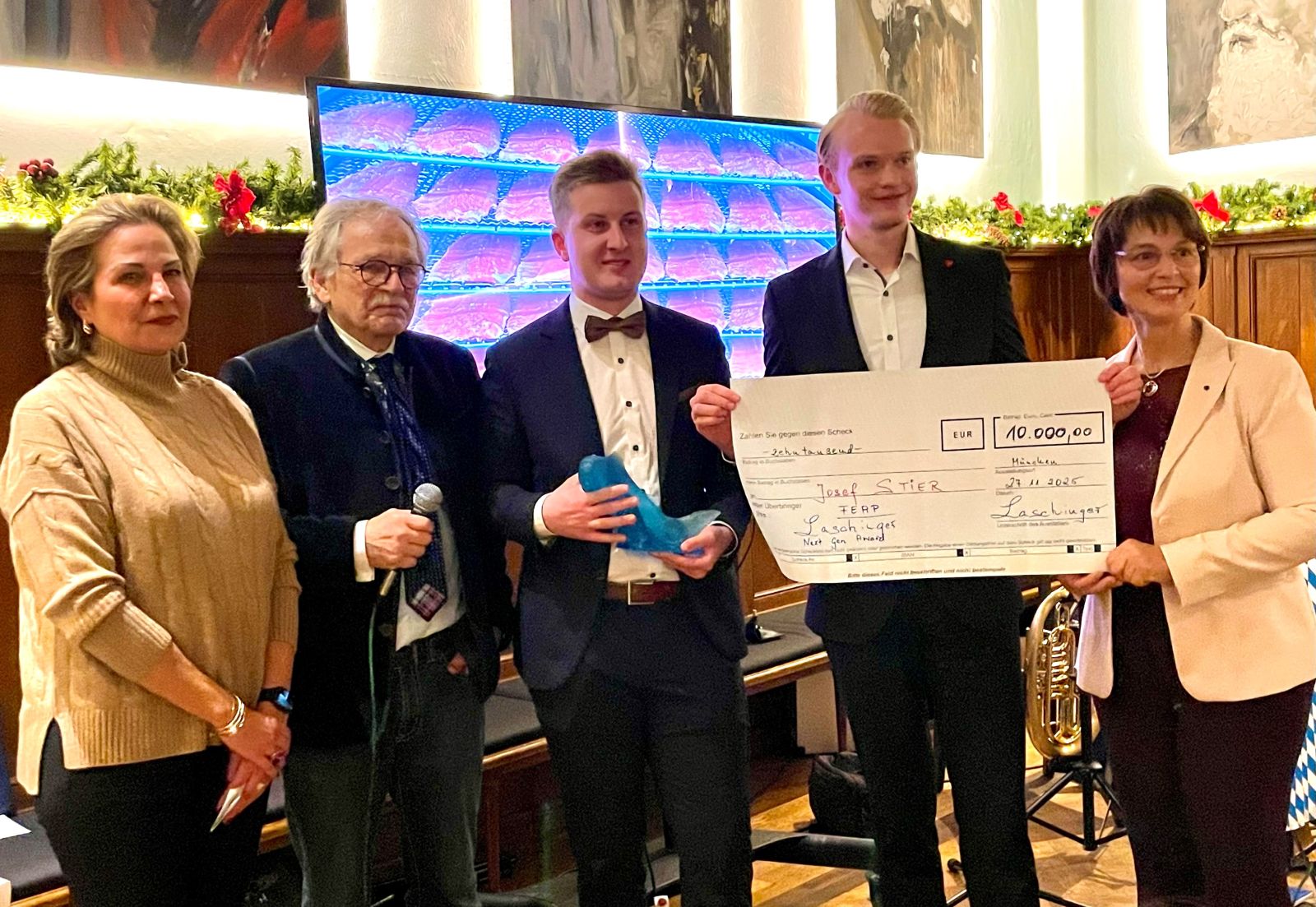
Foto von links nach rechts: FEAP Präsidentin Lara Barazi, VDBA Präsident Bernhard Feneis, Preisträger Josef Stier, Lauri Laschinger (Enkel des kürzlich verstorbenen Preisstifters Rudolf Laschinger) und Ulrike Müller (Abgeordnete im Bayerischen Landtag, Europaabgeordnete bis 2024)
Das Highlight des zweitägigen Meetings war die erstmalige Vergabe des FEAP–Laschinger NextGen Awards.
Der VDBA ist besonders stolz, dass als erster Preisträger ein leuchtender Stern unserer Young Fishermen von der internationalen Jury einstimmig ausgewählt wurde!
Die moderne Indoor-Zuchtanlage von Josef Stier in Bärnau verfügt über eigene Tiefbrunnen, einen mit Hackschnitzel befeuerten Holzvergaser, ein Blockheizkraftwerk und eine Photovoltaik-Anlage. Diese Kombination macht es möglich, eine nachhaltige und kosteneffiziente Produktion von Zander, Aalen, Regenbogenforellen, Bachforellen, Lachsforellen und sogar Garnelen sicherzustellen. Weil das Wasser in den Kreislaufanlagen kontinuierlich mechanisch und biologisch gereinigt sowie mit UV-Licht behandelt wird, ist auch der Wasserverbrauch extrem niedrig. Im Rahmen eines Forschungsprojekts mit der Landesanstalt für Landwirtschaft wird in einer modernen robotergestützten Anlage zusätzlich eigenes, hochwertiges und proteinreiches Fischfutter in Kreislaufproduktion aus organischen Abfällen für schwarze Soldatenfliegen produziert.
Dieses innovative, ganzheitliche Konzept ist ein Leuchtturm-Beispiel für nachhaltige und verantwortungsvolle Lebensmittelproduktion und verdient die Anerkennung durch den FEAP–Laschinger NextGen Award.
Wir gratulieren Josef Stier ganz herzlich zu dieser wohlverdienten Anerkennung!
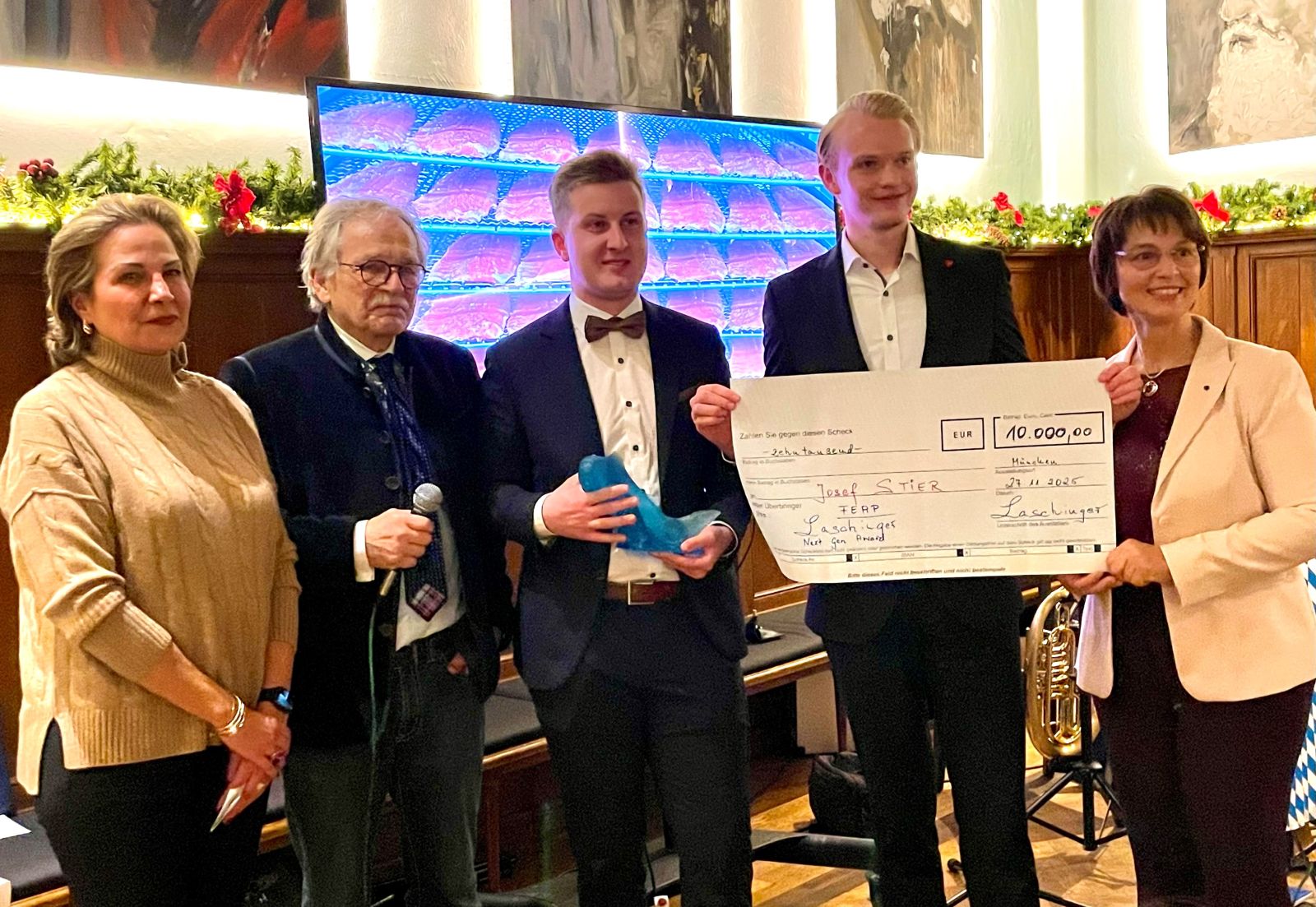
Foto von links nach rechts: FEAP Präsidentin Lara Barazi, VDBA Präsident Bernhard Feneis, Preisträger Josef Stier, Lauri Laschinger (Enkel des kürzlich verstorbenen Preisstifters Rudolf Laschinger) und Ulrike Müller (Abgeordnete im Bayerischen Landtag, Europaabgeordnete bis 2024)
16.11.2025
Fischotter: Süß, streng geschützt – doch für Fischwirte fatal
Sehenswerter Bericht des Bayrischen Fernsehens zum "Fischotter-Teichwirtschaftsproblem"
Für Teichwirte keine Neuigkeit: der Fischotter richtet weiterhin große Schäden an.
Dies zeigt auch der neue, sehenswerte Bericht Fischotter: Süß, streng geschützt – doch für Fischwirte fatal des Bayrischen Fernsehens.
Seit dem Jahr 2016 gibt es in Bayern ein Fischottermanagement, das auf Beratung, Zaunbau und Entschädigung setzt. Doch Elektro- und feste Schutzzäune werden nur mit 60 Prozent gefördert. Dies basiert auf der Rahmenrichtlinie für den Ausgleich von durch geschützte Tiere verursachten Schäden in der Fischerei und Aquakultur.
Die Errichtung von Schutzzäunen ist oft jedoch nicht praktikabel (Größe und Terrain der Teichflächen), sehr teuer und würde das wichtige aquatische Habitat und die Wasserversorgung auch für andere Tiere versperren. Auch Ausgleichszahlungen wie durch den Freistaat Bayern (im vergangenen Jahr in Höhe von 2,25 Mio. Euro – 97 Prozent der den Betrieben entstandenen Verluste) sind keine dauerhafte Lösung und der finanzielle Bedarf steigt jährlich.
So ist es nicht überraschend, dass Otter-Schäden Fischzüchter zur Betriebsaufgabe bewegen.
Anhand der Zahlen des Statistischen Berichts der Aquakultur lässt sich ein deutlicher Rückgang an Betrieben belegen. So gab es im Jahr 2011 noch 2.984 Betriebe mit Erzeugung von Fischen in Teichen (Fachserie 3 Reihe 4.6 - Erzeugung in Aquakulturbetrieben - 2011), während es 2024 nur noch 1.310 Betriebe waren (Statistischer Bericht - Aquakultur - 2024).
Dieser sehr deutliche Rückgang von 1.674 Betrieben (56.1 %) in den letzten 13 Jahren ist hochgradig besorgniserregend und teilweise auch auf die allgemeine Prädatoren-Problematik zurückzuführen.
Zu der Diskussion über den Umgang mit Prädatoren gibt es ein interessantes Interview mit Prof Dr. Sven Herzog, Dozent für Wildökologie und Jagdwirtschaft an der TU Dresden: „ln den letzten 100 Jahren ist keine Art, die dem Jagd recht unterlag, ausgestorben" zum download.
Dies zeigt auch der neue, sehenswerte Bericht Fischotter: Süß, streng geschützt – doch für Fischwirte fatal des Bayrischen Fernsehens.
Seit dem Jahr 2016 gibt es in Bayern ein Fischottermanagement, das auf Beratung, Zaunbau und Entschädigung setzt. Doch Elektro- und feste Schutzzäune werden nur mit 60 Prozent gefördert. Dies basiert auf der Rahmenrichtlinie für den Ausgleich von durch geschützte Tiere verursachten Schäden in der Fischerei und Aquakultur.
Die Errichtung von Schutzzäunen ist oft jedoch nicht praktikabel (Größe und Terrain der Teichflächen), sehr teuer und würde das wichtige aquatische Habitat und die Wasserversorgung auch für andere Tiere versperren. Auch Ausgleichszahlungen wie durch den Freistaat Bayern (im vergangenen Jahr in Höhe von 2,25 Mio. Euro – 97 Prozent der den Betrieben entstandenen Verluste) sind keine dauerhafte Lösung und der finanzielle Bedarf steigt jährlich.
So ist es nicht überraschend, dass Otter-Schäden Fischzüchter zur Betriebsaufgabe bewegen.
Anhand der Zahlen des Statistischen Berichts der Aquakultur lässt sich ein deutlicher Rückgang an Betrieben belegen. So gab es im Jahr 2011 noch 2.984 Betriebe mit Erzeugung von Fischen in Teichen (Fachserie 3 Reihe 4.6 - Erzeugung in Aquakulturbetrieben - 2011), während es 2024 nur noch 1.310 Betriebe waren (Statistischer Bericht - Aquakultur - 2024).
Dieser sehr deutliche Rückgang von 1.674 Betrieben (56.1 %) in den letzten 13 Jahren ist hochgradig besorgniserregend und teilweise auch auf die allgemeine Prädatoren-Problematik zurückzuführen.
Zu der Diskussion über den Umgang mit Prädatoren gibt es ein interessantes Interview mit Prof Dr. Sven Herzog, Dozent für Wildökologie und Jagdwirtschaft an der TU Dresden: „ln den letzten 100 Jahren ist keine Art, die dem Jagd recht unterlag, ausgestorben" zum download.
13.11.2025
EU Halbzeitbewertung der Umsetzung der Aquakultur Leitlinien (2021–2030) und Nationalen Strategiepläne veröffentlicht
Die Europäische Kommission hat ihre Halbzeitbewertung der Umsetzung der Strategischen Leitlinien der EU für die Aquakultur (2021–2030) und der zugehörigen Mehrjährigen Nationalen Strategiepläne (MNSP) veröffentlicht. Die Bewertung beurteilt die Fortschritte bei der Umsetzung empfohlener Maßnahmen und deren Wirksamkeit bei der Erreichung der Ziele und identifiziert gleichzeitig Bereiche, die Anpassungen erfordern.
Leider sind nur wenige positive Fortschritte festzustellen. Die Fortschritte sind uneinheitlich, und die Effizienz wird durch anhaltende Hindernisse wie komplexe Genehmigungsverfahren, begrenzten Zugang zu Flächen und Wasser, geringe gesellschaftliche Akzeptanz und langsame Innovationsübernahme beeinträchtigt.
Um die Ziele für 2030 zu erreichen, sind eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und der Raumplanung, die Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien mit ausreichender Finanzierung, erhöhte Investitionen in Tiergesundheit und Tierschutz, der Ausbau erneuerbarer Energien und Kreislaufwirtschaftspraktiken sowie eine verstärkte Verbreitung von Leitlinien zu bewährten Verfahren an Behörden und Erzeuger erforderlich.
Leider sind nur wenige positive Fortschritte festzustellen. Die Fortschritte sind uneinheitlich, und die Effizienz wird durch anhaltende Hindernisse wie komplexe Genehmigungsverfahren, begrenzten Zugang zu Flächen und Wasser, geringe gesellschaftliche Akzeptanz und langsame Innovationsübernahme beeinträchtigt.
Um die Ziele für 2030 zu erreichen, sind eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und der Raumplanung, die Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien mit ausreichender Finanzierung, erhöhte Investitionen in Tiergesundheit und Tierschutz, der Ausbau erneuerbarer Energien und Kreislaufwirtschaftspraktiken sowie eine verstärkte Verbreitung von Leitlinien zu bewährten Verfahren an Behörden und Erzeuger erforderlich.
Ohne eine Bewältigung dieser systemischen Herausforderungen droht der Aquakultur in der EU trotz starker politischer Unterstützung eine anhaltende Stagnation, da grundlegende Probleme, insbesondere die administrative Komplexität und die Flächenverteilung, das Wachstum weiterhin einschränken.
Der englische Originalreport kann hier runtergeladen werden.
Der englische Originalreport kann hier runtergeladen werden.
06.11.2025
2025 Treffen der VDBA Einzelmitglieder in Aachen
Am 03. & 04.11. fand das 2025 VDBA Einzelmitgliedertreffen statt. Die bereits in Nürnberg verabschiedete Neuausrichtung des VDBA mit der Listung der „Young Fishermen“ als eigene Sparte und dem Wechsel der Geschäftsführung zum 01.01.26 wurde erneut erläutert und erhielt vollste Zustimmung.
Weitere Diskussionspunkte und Anliegen der Mitglieder wurden erörtert und in konstruktiven Meinungsaustauschen besprochen.
Als Mitausrichter hatte Familie Mohnen nach Aachen geladen, wo es eine Stadtführung und anschließende Betriebsbesichtigung in der Voreifel gab. Seit mehr als fünf Jahrzehnten steht der Name MOHNEN aquaculture für erstklassige Forellen aus einem inzwischen schon in der dritten Generation geführten Familienbetrieb.
Wir bedanken uns bei allen erschienenen Mitgliedern für das gesellige Miteinander, ihre aktiven Beiträge und besonders bei unserem ehemaligen Präsidenten Elmar, seinem Bruder Udo und seinem Sohn Philipp Mohnen für die tolle Organisation vor Ort.

Anwesende von links: Anja Oest (zukünft. VDBA Geschäftsführung), Isabell Schwegel (Young Fishermen), Ramona Oppermann & Gerd Michaelis (Spreewaldfisch GmbH), David Märkl-Bilger (WATER - proved GmbH / Bundesverband-Aquakultur), Philipp Mohnen (MOHNEN aquaculture), Michael Kamp (Lambachtaler Forellenzucht & Räucherei), Markus Nolda (ForellenZucht HochSpessart), Torben Heese (Aschauteiche), Frank Ehrmann (Forellenhof Thießen), Thomas Marek & Nachfolger André Schaller (Trouw Nutrition), Kerstin & Markus Lichtenecker (Forellenhof Themar), Bernhard Feneis (VDBA Präsident), Alexander Wever (NRW), Peter Grimm (ForellenZucht HochSpessart), Elmar Mohnen (MOHNEN aquaculture), Maite & Michael Kauth (Fischzucht Kauth)

28.10.2025
Der erste „FEAP-LASCHINGER NextGen Award“ wird diesen November in München verliehen
Der „Laschingerpreis“ würdigt junge Fachkräfte der europäischen Aquakultur, die herausragendes Unternehmertum, Führungsqualitäten und Engagement für nachhaltige Produktion beweisen. Der im Rahmen der FEAP NextGen-Initiative ins Leben gerufene Preis würdigt Persönlichkeiten, die Herausforderungen erfolgreich gemeistert und Innovationen in der Branche vorangetrieben haben. Durch die Anerkennung ihrer Leistungen und die Vernetzung mit Kollegen und nationalen Aquakulturverbänden in ganz Europa möchte die Initiative die nächste Generation von Produzenten inspirieren und die Sichtbarkeit und Dynamik der europäischen Aquakulturgemeinschaft stärken.
Berufsverbände der Aquakultur aus allen europäischen Ländern können Nominierungen einreichen. Diese Bewerbungen müssen an das FEAP-Sekretariat gesendet werden. Einzelpersonen oder andere Personen können sich nicht bewerben.
Der FEAP-Laschinger-Preis ist mit einem Preisgeld von 10.000 Euro dotiert und wird zukünftig alle zwei Jahre verliehen. Die Gewinner werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens zur Preisübergabe auf der FEAP-Jahresversammlung eingeladen.
FEAP Pressemitteilung lesen (Englisch)
Berufsverbände der Aquakultur aus allen europäischen Ländern können Nominierungen einreichen. Diese Bewerbungen müssen an das FEAP-Sekretariat gesendet werden. Einzelpersonen oder andere Personen können sich nicht bewerben.
Der FEAP-Laschinger-Preis ist mit einem Preisgeld von 10.000 Euro dotiert und wird zukünftig alle zwei Jahre verliehen. Die Gewinner werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens zur Preisübergabe auf der FEAP-Jahresversammlung eingeladen.
FEAP Pressemitteilung lesen (Englisch)
28.10.2025
Young Fishermen im Austausch mit der Staatssekretärin des BMLEH Martina Englhardt-Kopf
Die Fischerei in Deutschland wird nach wie vor massiv durch Prädatoren unter Druck gesetzt. Um zu sehen welche Folgen dies für die Natur und die Fischereibetriebe hat besuchte die parlamentarische Staatssekretärin des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat Fr. Martina Englhardt-Kopf das Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth (Oberpfalz, Bayern).
Neben Anna Klupp als Vertreterin der Young Fishermen waren auch Ely Eibisch, Wolfgang Stock (BBV), Landrat Roland Grillmeier und Thomas Beer (ARGE Fisch) vor Ort, um die drastische Situation zu schildern.
Neben den Prädatoren wurde auch angesprochen welche Weichen gestellt werden müssen, um Betriebe in die nächste Generation zu führen. Das Positionspapier der YFM wurde Frau Englhard-Kopf im Nachgang übermittelt.
Foto (vlnr): Wolfgang Stock, Martina Englhard-Kopf, Anna Klupp, Thomas Beer

.
Titelfoto links oben: Anna Klupp, Thomas Beer, Roland Grillmeier, Martina Englhard-Kopf und Ely Eibsich im Gespräch im Land der 1000 Teiche
Neben Anna Klupp als Vertreterin der Young Fishermen waren auch Ely Eibisch, Wolfgang Stock (BBV), Landrat Roland Grillmeier und Thomas Beer (ARGE Fisch) vor Ort, um die drastische Situation zu schildern.
Neben den Prädatoren wurde auch angesprochen welche Weichen gestellt werden müssen, um Betriebe in die nächste Generation zu führen. Das Positionspapier der YFM wurde Frau Englhard-Kopf im Nachgang übermittelt.
Foto (vlnr): Wolfgang Stock, Martina Englhard-Kopf, Anna Klupp, Thomas Beer

.
Titelfoto links oben: Anna Klupp, Thomas Beer, Roland Grillmeier, Martina Englhard-Kopf und Ely Eibsich im Gespräch im Land der 1000 Teiche
01.10.2025
VDBA beim Landwirtschaftsminister zum Verbändegespräch Fischerei in Berlin
Bernhard Feneis (Präsident des VDBA) und Ronald Menzel (Geschäftsführung) sind der Einladung von Alois Rainer (CSU), Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat im Kabinett Merz, zum Gespräch mit Fischereiverbänden am 29.09.2025 gefolgt.
Bei einem konstruktiven Austausch mit Bundesminister Rainer und Fischereireferent des Bundes Stefan Hübner (Leiter des Referats Fischereistruktur- und -marktpolitik, Meeresumweltschutz, EMFAF), konnten die Belange und Vertretungsziele des VDBA erfolgreich platziert werden.
Hintergrund des Termins waren Gespräche beim deutschen Fischereitag am 1. Juli 2025, durch die der Landwirtschaftsminister einen ersten Überblick über die Herausforderungen der Berufs- und Freizeitfischerei, der Aquakultur sowie der Fischwirtschaft in Deutschland im Allgemeinen gewinnen konnte. Vielfach ist den Akteuren der Branche gegenwärtig ein wirtschaftliches Arbeiten erschwert oder nicht mehr möglich. Die Ursachen sind vielfältig: u. A. schlechte Bestands- und Umweltsituationen, Klimawandel, Prädatoren, Energiepreise, Flächenverluste, bürokratische Hindernisse und politische Unsicherheiten. Das Resultat ist eine sinkende Eigenversorgung mit lokalen Fischprodukten.
Daher hat sich Landwirtschaftsminister Alois Rainer zum politischen Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen, auch mit Blick auf die Ernährungssicherung, zu verbessern. Zur Vertiefung dieser und weiteren Themen hatte er den in Nürnberg anwesenden Akteuren zugesagt, zeitnah ein entsprechendes Kennlerngespräch zu führen, das nun am 29. September stattgefunden hat.
Wir bleiben zu den vielen aktuellen Themen und Problemstellungen im Austausch mit dem BMLEH und bedanken uns bei der Bundesregierung für die Möglichkeit des Verbändegesprächs.
Foto: Stefan Hübner / BMLEH
Hintergrund des Termins waren Gespräche beim deutschen Fischereitag am 1. Juli 2025, durch die der Landwirtschaftsminister einen ersten Überblick über die Herausforderungen der Berufs- und Freizeitfischerei, der Aquakultur sowie der Fischwirtschaft in Deutschland im Allgemeinen gewinnen konnte. Vielfach ist den Akteuren der Branche gegenwärtig ein wirtschaftliches Arbeiten erschwert oder nicht mehr möglich. Die Ursachen sind vielfältig: u. A. schlechte Bestands- und Umweltsituationen, Klimawandel, Prädatoren, Energiepreise, Flächenverluste, bürokratische Hindernisse und politische Unsicherheiten. Das Resultat ist eine sinkende Eigenversorgung mit lokalen Fischprodukten.
Daher hat sich Landwirtschaftsminister Alois Rainer zum politischen Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen, auch mit Blick auf die Ernährungssicherung, zu verbessern. Zur Vertiefung dieser und weiteren Themen hatte er den in Nürnberg anwesenden Akteuren zugesagt, zeitnah ein entsprechendes Kennlerngespräch zu führen, das nun am 29. September stattgefunden hat.
Wir bleiben zu den vielen aktuellen Themen und Problemstellungen im Austausch mit dem BMLEH und bedanken uns bei der Bundesregierung für die Möglichkeit des Verbändegesprächs.
Foto: Stefan Hübner / BMLEH
25.09.2025
Anhörung zu „Wasserresilienzstrategie“ und „Kormorane“ im European Agriculture and Fisheries Council
Der Europäische Rat für Landwirtschaft und Fischerei (Agriculture and Fisheries Council) hat am 23. September 2025 zu den Themen „Wasserresilienzstrategie“ und „Kormorane“ unter dem Punkt "Any Other Business" eine Anhörung gehabt.
Beide Mitschnitte der öffentlichen Sitzung sind hier in deutscher Sprache als Download abrufbar.
Die Kommission will offensichtlich keine schnellen Lösungen zum Kormoranproblem finden, sondern nur weitere neue Leitlinien entwickeln.
Dabei bedarf es sofortiger Handlung, zum Schutz der Biodiversität, der Gewässergüte, vor Schäden in der Aquakultur und zum Erhalt der fischereilichen Nutzungsfähigkeit unserer Gewässer.
Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, damit die EU das offensichtliche Problem nicht weiter auf die lange Bank schiebt und endlich gehandelt wird.
Beide Mitschnitte der öffentlichen Sitzung sind hier in deutscher Sprache als Download abrufbar.
Die Kommission will offensichtlich keine schnellen Lösungen zum Kormoranproblem finden, sondern nur weitere neue Leitlinien entwickeln.
Dabei bedarf es sofortiger Handlung, zum Schutz der Biodiversität, der Gewässergüte, vor Schäden in der Aquakultur und zum Erhalt der fischereilichen Nutzungsfähigkeit unserer Gewässer.
Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, damit die EU das offensichtliche Problem nicht weiter auf die lange Bank schiebt und endlich gehandelt wird.
17.09.2025
EIFAAC Tagungsdokumente zu Managementempfehlungen zu Kormoranprädation
Das Sekretariat der EIFAAC (European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission) hat die Tagungsdokumente der Konferenz „Managementempfehlungen zur Reduzierung der Auswirkungen der Fischräuberei durch Kormorane“ vom 3. Juni 2025 veröffentlicht.
Die englischen Tagungsdokumente können unter https://doi.org/10.4060/cd6718en herunterladen werden.
Anhang D des Protokolls enthält die neueste, überarbeitete Fassung des Rahmens für einen europäischen Managementplan für den Kormoran. Er basiert auf den Stellungnahmen, die im Juni 2025 während und nach der Konferenz eingegangen sind.
Anhang D des Protokolls enthält die neueste, überarbeitete Fassung des Rahmens für einen europäischen Managementplan für den Kormoran. Er basiert auf den Stellungnahmen, die im Juni 2025 während und nach der Konferenz eingegangen sind.
Zusammenfassung: Die Konferenz zum Thema „Managementempfehlungen zur Verringerung der Auswirkungen der Kormoran-Prädation” fand am 3. Juni 2025 in Brüssel, Belgien, statt. Sie wurde von der polnischen EU-Ratspräsidentschaft ausgerichtet und von der Europäischen Beratenden Kommission für Binnenfischerei und Aquakultur (EIFAAC) organisiert. An der Konferenz nahmen 230 Teilnehmer aus 31 Ländern teil, darunter nationale Behörden, die Europäische Kommission, Vertreter des Europäischen Parlaments und ein breites Spektrum von Interessengruppen aus den Bereichen Fischerei, Aquakultur, Vogel- und Fischschutz sowie Beratungsorganisationen. Ziel der Konferenz war es, die Teilnehmer über die ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Kormoranjagd zu informieren, den Entwurf eines europäischen Managementplans für den Kormoran vorzustellen und den Dialog über mögliche Managementlösungen zu fördern. In den Eröffnungsreden wurde der grenzüberschreitende Charakter der Auswirkungen des Kormorans und die seit langem bestehenden Forderungen nach koordinierten europäischen Maßnahmen hervorgehoben. Die polnische Ratspräsidentschaft, die Europäische Kommission und die FAO betonten die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit, wissenschaftlicher Grundlagen und der Angleichung an bestehende EU-Rechtsrahmen. In den Diskussionen wurde die weitgehende Übereinstimmung mit dem Rahmenplan für den europäischen Managementplan für den Kormoran und die Notwendigkeit praktischer, koordinierter Lösungen zur Eindämmung der Kormoran-Raubzüge unter Wahrung des ökologischen Gleichgewichts und der Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften hervorgehoben. Zu den wichtigsten Empfehlungen gehörten: die Straffung der Ausnahmeregelungen im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie, die Festlegung von Referenzwerten und Schwellenwerten für nachhaltige Kormoran- und Fischpopulationen, die Verbesserung der grenzüberschreitenden Datenerhebung und -überwachung sowie die Einrichtung harmonisierter Entschädigungsregelungen für Schäden in der Fischerei und Aquakultur. Die Interessengruppen betonten die Dringlichkeit, gegen den Raubdruck vorzugehen, da sich die derzeitigen Maßnahmen oft als fragmentiert oder unwirksam erwiesen haben. Es wurden schnellere Maßnahmen zur Unterstützung von Fischern und Fischzüchtern gefordert, die mit unmittelbaren Herausforderungen konfrontiert sind. Der Aquakultursektor betonte sein Recht und seine Verantwortung, die Gesundheit und das Wohlergehen der Fische zu schützen, und sprach sich für vereinfachte, längerfristige Ausnahmeregelungen und Entschädigungen aus Mitteln für die Entwicklung des ländlichen Raums oder aus Umweltfonds statt aus Mitteln für die Entwicklung der Aquakultur aus. Naturschutzverbände hoben die Notwendigkeit hervor, die ökologische Integrität zu erhalten, und warnten davor, Kormorane unverhältnismäßig für den Rückgang der Fischbestände verantwortlich zu machen. Sie drängten darauf, den Fokus auf umfassendere Stressfaktoren für das Ökosystem wie die Verschlechterung der Lebensräume zu legen. Die Teilnehmer aus europäischen Ländern wiesen auf die Bedeutung der Integration von Managementmaßnahmen in die nationalen Rechtssysteme und den Wert standardisierter Begründungen für Ausnahmeregelungen hin. Der von EIFAAC-Experten vorgestellte Entwurf eines Rahmenplans gliedert sich in fünf adaptive Schritte: Systembewertung, Entwicklung und Auswahl von Managementmaßnahmen, Politikformulierung und -koordinierung, Umsetzung und Überwachung sowie Bewertung und Anpassung. Der Plan zielt darauf ab, einen Ausgleich zwischen dem Schutz der Kormorane und einer nachhaltigen Fischerei und Aquakultur zu schaffen, den Dialog zwischen den Interessengruppen zu fördern und die Ziele der EU-Biodiversitäts- und Wasserrahmenrichtlinie zu unterstützen. Die Konferenz endete mit einem Aufruf zur weiteren Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern, der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und den Interessengruppen, um den Rahmen für die Managementplanung fertigzustellen. Die Teilnehmer wurden gebeten, bis zum 17. Juni 2025 Kommentare zum Planentwurf einzureichen. Der endgültige Plan wird den zuständigen europäischen Gremien zur Prüfung vorgelegt und spiegelt die gemeinsamen Beiträge und wissenschaftlichen Erkenntnisse wider, die im Laufe dieses Konsultationsprozesses gesammelt wurden.
Die auf der Konferenz gehaltenen Vorträge und die Rückmeldungen zum Entwurf des Plans sind unter https://www.fao.org/fishery/en/meeting/41505 auf Englisch verfügbar.
08.09.2025
Bis 3. Oktober Ideen einbringen: Öffentlichkeitsbeteiligung zur Wiederherstellung der Natur!
Bundesumweltministerium und Bundesamt für Naturschutz laden zur aktiven Mitgestaltung des Nationalen Wiederherstellungsplans ein
Ab sofort können sich Bürgerinnen und Bürger, Verbände sowie weitere Interessierte aktiv im Rahmen der Durchführung der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur beteiligen. Das Bundesumweltministerium (BMUKN) und das Bundesamt für Naturschutz (BfN) haben dafür eine Online-Plattform eingerichtet. Dort werden bis 3. Oktober 2025 Hinweise und Anregungen gesammelt. Die EU-Verordnung zielt darauf ab, Natur und Lebensräume besser zu schützen und wiederherzustellen – als unverzichtbare Grundlage für unsere Lebensqualität und Wirtschaft.
Der VDBA empfiehlt dringend, sich auf der Seite umzusehen und sich dort einzubringen. In der Umsetzung der EU-Wiederherstellungsverordnung und speziell im Wiederherstellungsplan liegen gleichermaßen Chancen und Risiken für Fischerei und Fischzucht.
Auf der Online-Plattform Beteiligung zur Wiederherstellung der Natur - Dialog BMUV stehen verschiedene Beteiligungsformate zur Verfügung:
- Umfrage: Für alle, die ihre Wahrnehmungen, Erwartungen und Informationsbedarfe mitteilen möchten.
- Fachspezifische Beteiligung: Für Stakeholder, die gezielt ihre Einschätzungen und Vorschläge zu einzelnen Themen wie Wäldern, Meeren, Flüssen und Auen, Landwirtschaft oder Natur in der Stadt mitteilen wollen.
- Ideen-Pinnwand: Für positive Beispiele, Forschungsergebnisse oder Praxisvorschläge zur Wiederherstellung der Natur.
Pressemitteilung BMUKN & BfN:
"Gesunde Wälder, saubere Flüsse, intakte Böden, nasse Moore und städtische Grünflächen sind eine unverzichtbare Grundlage für Gesundheit, Wohlstand und Lebensqualität. Sie sorgen für saubere Luft und ausreichend Wasser, speichern Kohlendioxid, schützen vor den Folgen des Klimawandels und sind essenziell für die Produktion von Lebensmitteln. Gleichzeitig fördern sie nachhaltig die Artenvielfalt und bieten Räume für Erholung und Freizeit. Wo Ökosysteme geschädigt sind, gilt es, sie wiederherzustellen und in einen guten Zustand zu versetzen. Das ist das Ziel der EU-Wiederherstellungsverordnung.
Bis zum 1. September 2026 müssen alle EU-Mitgliedstaaten gemäß EU-Verordnung einen Nationalen Wiederherstellungsplan erstellen. Dieser soll gezielte Maßnahmen bündeln, die Wälder, Flüsse und Auen, Böden, Moore, Küsten und städtischen Grünflächen schützen und stärken sollen.
In Deutschland erarbeitet die Bundesregierung den Nationalen Wiederherstellungsplan in enger Abstimmung mit den Ländern. Ziel ist es, wirksame und umsetzbare Maßnahmen zu entwickeln, die von der Gesellschaft mitgetragen werden.
Das Bundesumweltministerium (BMUKN) und das Bundesamt für Naturschutz (BfN) laden die Öffentlichkeit und Stakeholder ein, diesen Prozess aktiv mitzugestalten. Zu diesem Zweck wurde eine eigene Beteiligungsplattform eingerichtet."
Bis zum 1. September 2026 müssen alle EU-Mitgliedstaaten gemäß EU-Verordnung einen Nationalen Wiederherstellungsplan erstellen. Dieser soll gezielte Maßnahmen bündeln, die Wälder, Flüsse und Auen, Böden, Moore, Küsten und städtischen Grünflächen schützen und stärken sollen.
In Deutschland erarbeitet die Bundesregierung den Nationalen Wiederherstellungsplan in enger Abstimmung mit den Ländern. Ziel ist es, wirksame und umsetzbare Maßnahmen zu entwickeln, die von der Gesellschaft mitgetragen werden.
Das Bundesumweltministerium (BMUKN) und das Bundesamt für Naturschutz (BfN) laden die Öffentlichkeit und Stakeholder ein, diesen Prozess aktiv mitzugestalten. Zu diesem Zweck wurde eine eigene Beteiligungsplattform eingerichtet."
03.09.2025
Neue Positionspapiere der YOUNG FISHERMEN
Die YOUNG FISHERMEN haben, um die Zukunft der Fischerei mitzugestalten ein Positionspapier erarbeitet, das aufzeigt welche Weichen junge Fischer/innen brauchen, um Betriebe übernehmen und weiterführen zu können.
Weiterhin haben die YOUNG FISHERMEN Vorschläge eingereicht, wie der EMFAF in der zukünftigen Förderperiode verändert werden kann, um den Bedürfnissen der Praxis besser zu entsprechen.
Beide Dokumente sind als Download beigefügt.
Weiterhin haben die YOUNG FISHERMEN Vorschläge eingereicht, wie der EMFAF in der zukünftigen Förderperiode verändert werden kann, um den Bedürfnissen der Praxis besser zu entsprechen.
Beide Dokumente sind als Download beigefügt.
03.09.2025
Möglichkeit der Stellungnahme zur Vereinfachung der Verwaltung im Bereich des Umweltrechts
In den politischen Leitlinien der Kommissionspräsidentin für das Mandat 2024-2029 wird der Umsetzung und Vereinfachung große Bedeutung beigemessen. Die Kommission prüft derzeit Umweltrechtsvorschriften, um Gesetzgebungsakte zu ermitteln, die ein erhebliches Potenzial zur Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben bergen. Der Verwaltungsaufwand soll verringert werden, ohne die im Rahmen der bestehenden Rechtsvorschriften vereinbarten Umweltziele zu beeinträchtigen. Weder sollen die Umweltziele der EU abgeschwächt noch der durch das EU-Umweltrecht garantierte Schutz der menschlichen Gesundheit verringert werden.
Bis 10.September.2025 ist es möglich am EU Konsultationsverfahren teilzunehmen unter folgendem Link:
Simplification of administrative burdens in environmental legislation
Damit der Verwaltungsaufwand zukünftig für kleine und mittlere Unternehmen überschaubar bleibt, sollte die EU Initiative zur Entbürokratisierung unterstützt werden.
Bis 10.September.2025 ist es möglich am EU Konsultationsverfahren teilzunehmen unter folgendem Link:
Simplification of administrative burdens in environmental legislation
Damit der Verwaltungsaufwand zukünftig für kleine und mittlere Unternehmen überschaubar bleibt, sollte die EU Initiative zur Entbürokratisierung unterstützt werden.
28.07.2025
Sitzung des VDBA am Deutschen Fischereitag
Bei der Mitgliederversammlung des Verbandes der deutschen Binnenfischerei und Aquakultur (VDBA) am 02.07.2025 wurden wichtige Weichen für die Zukunft des VDBA gestellt:
- Neue Sparte „Young Fishermen“ (YFM) gegründet – einstimmig beschlossen
- Anna Klupp ist mit sofortiger Wirkung neue Spartenleiterin, unterstützt von Isabell Schwegel
- Als Beisitzer wurden Gero Weinhardt, Karl Bissa und Martin Weierich gewählt
- Ab 2026 wird die VDBA-Geschäftsstelle nach Hannover verlegt
- Frau Anja Oest übernimmt ab 2026 schrittweise die Geschäftsführung von Ronald Menzel
- Das Konzept wurde mit großer Mehrheit angenommen – ein starkes Signal für den Generationenwechsel!
Der Vortrag von Hrn. Lars Dettmann zum Europäischen Kormoranmanagement ist als Download beigefügt
- Neue Sparte „Young Fishermen“ (YFM) gegründet – einstimmig beschlossen
- Anna Klupp ist mit sofortiger Wirkung neue Spartenleiterin, unterstützt von Isabell Schwegel
- Als Beisitzer wurden Gero Weinhardt, Karl Bissa und Martin Weierich gewählt
- Ab 2026 wird die VDBA-Geschäftsstelle nach Hannover verlegt
- Frau Anja Oest übernimmt ab 2026 schrittweise die Geschäftsführung von Ronald Menzel
- Das Konzept wurde mit großer Mehrheit angenommen – ein starkes Signal für den Generationenwechsel!
Der Vortrag von Hrn. Lars Dettmann zum Europäischen Kormoranmanagement ist als Download beigefügt
03.06.2025
Netze zur Drohnenabwehr gesucht
Die Organisation Bravery Berlin sucht kaputte oder nicht mehr benötigte Zugnetzte, Stellnetze oder ähnliches. Die Netze können in der Ukraine genutzt werden, um Drohnen abzufangen. Die Propeller der Drohnen verfangen sich in den Netzen und können dadurch das Ziel nicht erreichen.
Jedes Netz hilft vor Ort Menschen zu schützen!
Wenn Sie Netze haben, die Sie nicht mehr brauchen wenden Sie sich bitte an Franz Kühn (frakue@freenet.de). Er koordiniert die Weitergabe an Bravery Berlin.
Jedes Netz hilft vor Ort Menschen zu schützen!
Wenn Sie Netze haben, die Sie nicht mehr brauchen wenden Sie sich bitte an Franz Kühn (frakue@freenet.de). Er koordiniert die Weitergabe an Bravery Berlin.
14.03.2025
Young Fishermen im Podcast "Blaues Brot"
Blaues Brot
Die umfangreichste Audiodoku zum Lebensmittelsystem hat Anna Klupp als Vertreterin für die Teichwirtschaft eingeladen über die traditionelle Fischerzeugung zu berichten.
Ab Folge 4 ist sie regelmäßig im Podcast zu hören.
Der Podcast kann bei Spotify/Amazon Music/Apple Podcast gestreamt werden
Infos: Blaues Brot
Die umfangreichste Audiodoku zum Lebensmittelsystem
Die umfangreichste Audiodoku zum Lebensmittelsystem hat Anna Klupp als Vertreterin für die Teichwirtschaft eingeladen über die traditionelle Fischerzeugung zu berichten.
Ab Folge 4 ist sie regelmäßig im Podcast zu hören.
Der Podcast kann bei Spotify/Amazon Music/Apple Podcast gestreamt werden
Infos: Blaues Brot
Die umfangreichste Audiodoku zum Lebensmittelsystem
14.03.2025
Naturschutzinitiative klagt gegen Fischotterabschuss in Bayern
Die Regierung der Oberpfalz hat im Februar Gebiete festgelegt, in denen Fischotter vergrämt und ggf abgeschossen werden dürfen. Gegen die Abschussverfügung klagt jetzt die Naturschutzinitiative (NI) und hat laut Pressemitteilung Eilantrag beim Verwaltungsgericht Regensburg eingereicht.
Die Naturschützer halten die Rechtsverordnung für einen „Formverstoß“.
Infos: NI klagt gegen Fischotterabschuss in Bayern | Naturschutzinitiative e.V.
Naturschutzinitiative e. V. klagt gegen Fischotterabschüsse | OberpfalzECHO
Die Naturschützer halten die Rechtsverordnung für einen „Formverstoß“.
Infos: NI klagt gegen Fischotterabschuss in Bayern | Naturschutzinitiative e.V.
Naturschutzinitiative e. V. klagt gegen Fischotterabschüsse | OberpfalzECHO
26.02.2025
FEAP veröffentlicht "FAKTEN ÜBER FINFISCH AQUAKULTUR"
Grafiken zur europäischen Fischproduktion
Die FEAP (Federation of the European Aquaculture Producers) hat Infografiken zur europäischen Fischerzeugung veröffentlicht. Darin wird einmal mehr die Bedeutung der Branche für eine nachhaltige Ernhährung und für die Erbringung von zahlreichen Ökosystemdienstleistungen dargestellt.
Die Grafiken sind im englischen Original und deutscher Übersetzung beigefügt.
Die Grafiken sind im englischen Original und deutscher Übersetzung beigefügt.
17.02.2025
Fischottermanagement: Maßnahmengebiete in der Oberpfalz festgelegt
Wo sind in der Oberpfalz ab sofort Maßnahmen gegen den Fischotter möglich? Als Höhere Naturschutzbehörde hat die Regierung der Oberpfalz sogenannte Maßnahmengebiete festgelegt. In den entsprechenden Gebieten ist es möglich, Fischotter zu fangen, zu vergrämen oder - als ultima ratio – zu entnehmen. Dadurch sollen ernste fischereiwirtschaftliche Schäden abgewendet und die Teich- und Fischereiwirtschaft geschützt werden.
Am 14. Februar 2025 trat die Allgemeinverfügung zur Festlegung der Maßnahmengebiete in Kraft. Die Maßnahmengebiete befinden sich in den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten Amberg-Sulzbach, Amberg, Cham, Neustadt a.d. Waldnaab, Weiden, Schwandorf und Tirschenreuth. Insgesamt können nach Vorgaben des Bayerischen Umweltministeriums jährlich in der Oberpfalz 23 Tiere entnommen werden.
Weitere Informationen hier
Am 14. Februar 2025 trat die Allgemeinverfügung zur Festlegung der Maßnahmengebiete in Kraft. Die Maßnahmengebiete befinden sich in den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten Amberg-Sulzbach, Amberg, Cham, Neustadt a.d. Waldnaab, Weiden, Schwandorf und Tirschenreuth. Insgesamt können nach Vorgaben des Bayerischen Umweltministeriums jährlich in der Oberpfalz 23 Tiere entnommen werden.
Weitere Informationen hier
28.01.2025
Verhaltenskodex für die europäische Aquakultur veröffentlicht
Das Hauptziel dieses Verhaltenskodex, der von der Föderation der europäischen Aquakulturproduzenten (FEAP) erstellt wurde, besteht darin, die verantwortungsvolle Entwicklung und das Management eines lebensfähigen europäischen Aquakultursektors zu fördern, um einen hohen Standard bei der Produktion von Qualitätslebensmitteln zu gewährleisten und dabei Umweltaspekte und die Anforderungen der Verbraucher zu berücksichtigen.
Als Verhaltenskodex dient dieses Dokument dazu, Leitprinzipien für diejenigen in Europa festzulegen und zu empfehlen, die lebende Fischarten durch Aquakultur produzieren.
Der Kodex zielt nicht darauf ab, zwischen den Arten oder den Arten oder Größenordnungen von Betrieben zu unterscheiden, die im europäischen Aquakultursektor anzutreffen sind.
Sein Zweck ist es, durch eine wirksame Selbstregulierung eine gemeinsame Grundlage für die sektorale Verantwortung innerhalb der Gesellschaft zu schaffen und die Überlegungen des Produktionssektors in Bezug auf die von ihm gezüchteten Fische, die Umwelt und den Verbraucher aufzuzeigen.
Als Verhaltenskodex dient dieses Dokument dazu, Leitprinzipien für diejenigen in Europa festzulegen und zu empfehlen, die lebende Fischarten durch Aquakultur produzieren.
Der Kodex zielt nicht darauf ab, zwischen den Arten oder den Arten oder Größenordnungen von Betrieben zu unterscheiden, die im europäischen Aquakultursektor anzutreffen sind.
Sein Zweck ist es, durch eine wirksame Selbstregulierung eine gemeinsame Grundlage für die sektorale Verantwortung innerhalb der Gesellschaft zu schaffen und die Überlegungen des Produktionssektors in Bezug auf die von ihm gezüchteten Fische, die Umwelt und den Verbraucher aufzuzeigen.
28.01.2025
Erstes Treffen der FEAP mit Kommissar Kadis
Am 24.01.2025 fand in Brüssel unser erstes Treffen mit dem EU-Kommissar für Fischerei und Ozeane, Costas Kadis, und seinen Kabinettsmitgliedern Antonio Basanta und Nikolaos Pieri statt. Der Europäische Verband der Fischereiindustrie (FEAP) wurde von unserer Präsidentin Lara Barazi-Geroulanou und Vizepräsidentin Anna Pyć in Begleitung von Szilvia Mihalffy und Javier Ojeda vertreten.
Am 25.01.2025 fand ein weiteres Treffen mit der DG Mare statt. Wir trafen uns mit Delilah Al Khudhairy (Direktorin für Meerespolitik und Blaue Wirtschaft), Felix Leinemann (Leiter der Abteilung für Blaue Wirtschaftssektoren, Aquakultur und maritime Raumplanung) und dem Aquakultur-Team unter der Leitung von Lorella de la Cruz und Emilia Gargallo.
Am 25.01.2025 fand ein weiteres Treffen mit der DG Mare statt. Wir trafen uns mit Delilah Al Khudhairy (Direktorin für Meerespolitik und Blaue Wirtschaft), Felix Leinemann (Leiter der Abteilung für Blaue Wirtschaftssektoren, Aquakultur und maritime Raumplanung) und dem Aquakultur-Team unter der Leitung von Lorella de la Cruz und Emilia Gargallo.
30.11.2024
Positionspapier zum Bedarf an koordinierten europäischen Managementmaßnahmen für den Kormoran
Die Populationen einiger geschützter Tierarten haben in den letzten Jahrzehnten in den europäischen ländlichen Binnen- und Küstenlandschaften in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen, und zwar weit über die historisch ermittelten Werte hinaus. Ohne aktives Eingreifen ist der Kormoran in der Lage, den gesamten Fischbestand auszurotten.
Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass nur ein europaweiter Managementplan, der auf regionaler Koordination beruht, akzeptable Ergebnisse in den verschiedenen Aspekten des Managements, einschließlich der Erhaltungsaspekte, liefern kann.
Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass nur ein europaweiter Managementplan, der auf regionaler Koordination beruht, akzeptable Ergebnisse in den verschiedenen Aspekten des Managements, einschließlich der Erhaltungsaspekte, liefern kann.
16.11.2024
Code of Good Practices on Fish Welfare among Aquaculture Producers
Die vom AAC herausgearbeitete Leitlinien für eine nachhaltigere und wettbewerbsfähigere Aquakultur für den Zeitraum 2021 bis 2030 unterstützt die Entwicklung eines Verhaltenskodex für den Schutz von Fischen auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung und wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Aufzucht, Transport und Tötung abdecken.
Bei diesem Ansatz hat das Wohlergehen von Fischen drei Dimensionen, erstens ein gutes funktionelles Wohlergehen, d. h. die Fische sind gesund, frei von Krankheiten und Verletzungen und befinden sich allgemein in einem guten körperlichen Zustand. Zweitens sind die Fische in der Lage, eine Reihe von motivierte natürliche Verhaltensweisen ausüben können, so dass sie nach Möglichkeit frei von Angst und Frustration sind und im Allgemeinen in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, die instinktiv gesteuert sind. Drittens kann das Erreichen dieser beiden Dimensionen kann drittens das psychische Wohlbefinden und eine gute Lebensqualität gewährleistet werden, auch wenn dies schwieriger zu messen sein mag. Die Bewertung des Wohlergehens hängt von der Entwicklung von Indikatoren ab, die in einigen Bereichen weiter fortgeschritten sind als in anderen.
Bei diesem Ansatz hat das Wohlergehen von Fischen drei Dimensionen, erstens ein gutes funktionelles Wohlergehen, d. h. die Fische sind gesund, frei von Krankheiten und Verletzungen und befinden sich allgemein in einem guten körperlichen Zustand. Zweitens sind die Fische in der Lage, eine Reihe von motivierte natürliche Verhaltensweisen ausüben können, so dass sie nach Möglichkeit frei von Angst und Frustration sind und im Allgemeinen in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, die instinktiv gesteuert sind. Drittens kann das Erreichen dieser beiden Dimensionen kann drittens das psychische Wohlbefinden und eine gute Lebensqualität gewährleistet werden, auch wenn dies schwieriger zu messen sein mag. Die Bewertung des Wohlergehens hängt von der Entwicklung von Indikatoren ab, die in einigen Bereichen weiter fortgeschritten sind als in anderen.
13.11.2024
Vorträge des HUNTATIP Workshops online
Die Vorträge des HUNATIP-Workshops "AQUAKULTUR ZU EINEM WICHTIGEN BESTANDTEIL DES NACHHALTIGEN LEBENSMITTELSYSTEMS IN EUROPA MACHEN" sind nun online nachzulesen.
Unter folgendem Link: HUNATiP Workshop Brussels – Programme – Hunatip
Aquaculture and the EU policy agenda
Lorella de la Cruz Iglesias (European Commission)
Role of aquaculture in the global food system and FAO’s Blue Transformation Roadmap
Raschad Al-Khafaji (FAO)
The need for an aquaculture policy reform
Brian Thomsen (AAC)
Navigating the future of EU aquaculture: key insights and strategies
Javier Ojeda (FEAP)
15.30–15.45 Priorities and opportunities for innovation in European aquaculture
David Bassett (EATiP)
Shellfish farming: A keystone in the European Turquoise Aquaculture Revolution
Thibault Pivetta (EMPA)
Aquaculture multifunctionality as a response to the challenges of sustainable development
Tomasz Kulikowski (MIR Gdynia, Poland)
Unter folgendem Link: HUNATiP Workshop Brussels – Programme – Hunatip
Aquaculture and the EU policy agenda
Lorella de la Cruz Iglesias (European Commission)
Role of aquaculture in the global food system and FAO’s Blue Transformation Roadmap
Raschad Al-Khafaji (FAO)
The need for an aquaculture policy reform
Brian Thomsen (AAC)
Navigating the future of EU aquaculture: key insights and strategies
Javier Ojeda (FEAP)
15.30–15.45 Priorities and opportunities for innovation in European aquaculture
David Bassett (EATiP)
Shellfish farming: A keystone in the European Turquoise Aquaculture Revolution
Thibault Pivetta (EMPA)
Aquaculture multifunctionality as a response to the challenges of sustainable development
Tomasz Kulikowski (MIR Gdynia, Poland)
04.11.2024
Anfrage des EU Abgeordneten David McAllister an die Kommission
Anfrage des EU Abgeordneten David McAllister an die Kommission "Stärkung der Binnenfischerei, Bewahrung des Angelns als Kulturgut, Erhaltung von Lebensraumtypen und Verbesserung des Artenschutzes"
29.10.2024
Fischotterausgleich in Bayern bis zu 100%
Seit 2016 gewährt die Staatsregierung Ausgleichszahlungen für Fischotterschäden. Die Zahl der Anträge und die Schadenssumme haben sich seitdem massiv erhöht. Die Staatsregierung hat aufgrund der großen Bedeutung der Fischerei die Mittel für die Ausgleichzahlungen auf nunmehr 2,2 Mio. Euro angehoben. Ab dem Schadensjahr 2024 ist grundsätzlich ein bis zu 100 %-iger Schadensausgleich möglich, wenn die bereitgestellten Mittel ausreichen.
Das Merkblatt sowie die Richtlinie sind als Download beigefügt.
Das Merkblatt sowie die Richtlinie sind als Download beigefügt.
29.10.2024
Workshop über die Zukunft der Aquakultur
Die ungarische EU-Ratspräsidentschaft veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Ungarischen Technologie- und Innovationsplattform für Aquakultur (HUNATiP) am 14. Oktober in der Ständigen Vertretung Ungarns bei der Europäischen Union in Brüssel einen Workshop über die Zukunft der Aquakultur. Bei dieser Veranstaltung hielt Javier Ojeda, Generalsekretär der FEAP, einen Vortrag, in dem er die wichtigsten Unterschiede zwischen der Aquakulturpolitik der Europäischen Kommission und derjenigen internationaler Organisationen wie der FAO (Vereinte Nationen) herausstellte.
Das Statement der FEAP im Anhang
Das Statement der FEAP im Anhang
08.10.2024
Offener Brief der FEAP und Copa Cogeca an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
Verschiedene Erzeugerorganisationen, u.a. die FEAP (Federation of European Aquaculture Producers) und die Copa Cogeca haben sich in einem offenen Brief an die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gewandt. Der Brief (sowie eine deutsche Übersetzung) kann heruntergeladen werden.
Die genannten Ziele sollen in das Visionspapier einzug finden und die EU-Landwirtschaft der nächsten Jahre mitgestalten.
Ziele sind u.a.:
- Neue Kenntnisse über Tierwohl und Tiergesundheit sollten den Erzeugern und den Veterinären einfacher zugänglich sein.
- Es sollte bei Ernährungsempfehlungen keine pauschale Ablehnung tierischer Lebensmittel erfolgen. Besser ist es die Verbraucher über die Erzeugung und Verarbeitung zu informieren.
- Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren beim Erlass neuer Tierschutzvorschriften
Die genannten Ziele sollen in das Visionspapier einzug finden und die EU-Landwirtschaft der nächsten Jahre mitgestalten.
Ziele sind u.a.:
- Neue Kenntnisse über Tierwohl und Tiergesundheit sollten den Erzeugern und den Veterinären einfacher zugänglich sein.
- Es sollte bei Ernährungsempfehlungen keine pauschale Ablehnung tierischer Lebensmittel erfolgen. Besser ist es die Verbraucher über die Erzeugung und Verarbeitung zu informieren.
- Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren beim Erlass neuer Tierschutzvorschriften
04.09.2024
Workshop zu Gesundheitsindikatoren für Karpfen am 19.09.2024 in Prag
Die Universität Kreta, PRORATA und das Biologiezentrum Cas begrüßen den zweiten Cure4Aqua-Workshop über Indikatoren für das Wohlergehen von Zuchtkarpfen, der am 19. September 2024 in der Tschechischen Republik stattfindet.
Internationale Experten werden auf der Tagung (19. September) den aktuellen Stand der Technik zum Wohlbefinden von Fischen in Seen diskutieren. Teilnehmen werden Experten aus der Wissenschaft, der Aquakulturindustrie, den zuständigen Behörden, einschlägigen Nichtregierungsorganisationen und Verbraucherverbänden. An dem Workshop zum Wissensaustausch über das Wohlergehen von Karpfen.
Link zur Veranstaltung: Home - 2nd Cure4Aqua Workshop
Internationale Experten werden auf der Tagung (19. September) den aktuellen Stand der Technik zum Wohlbefinden von Fischen in Seen diskutieren. Teilnehmen werden Experten aus der Wissenschaft, der Aquakulturindustrie, den zuständigen Behörden, einschlägigen Nichtregierungsorganisationen und Verbraucherverbänden. An dem Workshop zum Wissensaustausch über das Wohlergehen von Karpfen.
Link zur Veranstaltung: Home - 2nd Cure4Aqua Workshop
04.09.2024
Young Fishermen im Austausch mit der Freien Wähler Landtagsfraktion Bayern
Die Young Fishermen hatten am 30.08.2024 den Bayerischen Landtagsabgeordneten Martin Scharf zu Gast in der Waldnaabaue bei Tirschenreuth. Dabei wurden das enorme Potential für die regionale Erzeugung sowie die Ökosystemdienstleistungen der Teichwirtschaft besprochen. Selbstverständlich wurden auch unerfreulichere Themen, wie der Prädatorendruck oder Probleme bei der Weiterführung der Betriebe in die nächste Generation angesprochen.
12.08.2024
WORKSHOP ZUR ZUKUNFT DER AQUAKULTUR 14. OKTOBER 2024, BRÜSSEL
Die ungarische Ratspräsidentschaft der Europäischen Union veranstaltet am 14. einen Workshop zur Zukunft der Aquakultur Oktober 2024 in der Ständigen Vertretung Ungarns bei der Europäischen Union (Rue de Trèves 92-98, Brüssel, Belgien). Der halbtägige Workshop wird organisiert von der Ungarischen Aquakultur-Technologie- und Innovationsplattform (HUNATiP). Die Veranstaltung bietet Gelegenheit, Vertreter der zusammenzubringen Europäische Institutionen, Industrieorganisationen und Mitgliedstaaten zur Diskussion die unterschiedlichen Ansichten und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen für die Aquakultur Sektor der EU. Die formelle Einladung und das Programm werden zu gegebener Zeit verschickt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne unter kontaktieren HUFISH24@mfa.gov.hu.
08.08.2024
Hochwasserkatastrophe - Hilfe für Familie Dworak Wülmersen- Fischzuchtbetriebe Reinhardswald
An alle der Fischerei verbundenen Menschen, liebe Freunde, Geschäftspartner und Berufskollegen! In der Nacht zum 2. August 2024 wurde durch ein Unwetter innerhalb kürzester Zeit die gesamte Existenzgrundlage der Familie Dworak in Wülmersen, zerstört
Nach einem Starkregen mit mehr als 170 L/ m² wurde die gesamte Fischzucht in Wülmersen von unglaublichen Wassermassen überrollt.
Betriebsgebäude, Wohnhaus, Hälterung, Verarbeitung, Werkstatt und Direktvermarktung wurden so stark geschädigt, dass sogar Gebäude abgerissen werden müssen.
Die Schäden an den Teichen und dem Fischbestand sind verheerend.
Jegliche Maschinen wurden unter Wasser gesetzt, sind stark beschädigt oder völlig zerstört.
Das Betriebsinventar ist zum größten Teil zerstört oder nicht mehr auffindbar.
Eine außergewöhnliche Notsituation, die außergewöhnliche Unterstützung bedarf!
Da die Familienmitglieder und Mitarbeiter in vollem Arbeitseinsatz sind,
darf ich, in freundschaftlicher Verbundenheit zur Familie einen Teil der Hilfe mitorganisieren!
Das ist der Grund, warum ich Sie anschreibe und um Unterstützung bitte!
Wie können Sie helfen?
Geldspenden
Unter folgendem Link ist ein Spendenkonto eingerichtet, auf das direkt gespendet werden kann. Anklicken und sie kommen auf die Spendenseite!
https://gofund.me/3e3eaec2
Auf der Seite „gofundme“ Hochwasserkatastrophe-Spenden für Familie Dworak, Wülmersen
kann auf einfachem Weg über PayPal, Klarna oder Kreditkarte gespendet werden.
Kollegiale Unterstützung Fischzucht
Anschaffung von Inventar
Kurzfristige aktive Hilfestellung
Strukturelle Unterstützung Fischbestand
Für diese Art der Unterstützung wenden Sie sich bitte direkt an mich unter der E-Mail: mail@kaiuwebernhard.de
oder an Familie Dworak E-Mail : infos@fischzucht-dworak.de
Sie bekommen eine Rückmeldung auf Ihre E-mail!
Leiten Sie diese E-Mail weiter, um eine möglichst große Reichweite und Hilfe zu erzielen.
Gerne können Sie mich auch telefonisch unter 0171 54 60 578 erreichen!
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Hilfe, Unterstützung und Wertschätzung für Familie Dworak!
Kai Uwe Bernhard
Betriebsgebäude, Wohnhaus, Hälterung, Verarbeitung, Werkstatt und Direktvermarktung wurden so stark geschädigt, dass sogar Gebäude abgerissen werden müssen.
Die Schäden an den Teichen und dem Fischbestand sind verheerend.
Jegliche Maschinen wurden unter Wasser gesetzt, sind stark beschädigt oder völlig zerstört.
Das Betriebsinventar ist zum größten Teil zerstört oder nicht mehr auffindbar.
Eine außergewöhnliche Notsituation, die außergewöhnliche Unterstützung bedarf!
Da die Familienmitglieder und Mitarbeiter in vollem Arbeitseinsatz sind,
darf ich, in freundschaftlicher Verbundenheit zur Familie einen Teil der Hilfe mitorganisieren!
Das ist der Grund, warum ich Sie anschreibe und um Unterstützung bitte!
Wie können Sie helfen?
Geldspenden
Unter folgendem Link ist ein Spendenkonto eingerichtet, auf das direkt gespendet werden kann. Anklicken und sie kommen auf die Spendenseite!
https://gofund.me/3e3eaec2
Auf der Seite „gofundme“ Hochwasserkatastrophe-Spenden für Familie Dworak, Wülmersen
kann auf einfachem Weg über PayPal, Klarna oder Kreditkarte gespendet werden.
Kollegiale Unterstützung Fischzucht
Anschaffung von Inventar
Kurzfristige aktive Hilfestellung
Strukturelle Unterstützung Fischbestand
Für diese Art der Unterstützung wenden Sie sich bitte direkt an mich unter der E-Mail: mail@kaiuwebernhard.de
oder an Familie Dworak E-Mail : infos@fischzucht-dworak.de
Sie bekommen eine Rückmeldung auf Ihre E-mail!
Leiten Sie diese E-Mail weiter, um eine möglichst große Reichweite und Hilfe zu erzielen.
Gerne können Sie mich auch telefonisch unter 0171 54 60 578 erreichen!
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Hilfe, Unterstützung und Wertschätzung für Familie Dworak!
Kai Uwe Bernhard
15.07.2024
Austausch zwischen Bayern und Österreich
Der Landkreis Tirschenreuth empfing am 8.07.2024 den Geschäftsführer des Österreichischen Verbandes für Aquakultur und Teichwirtschaft Leo Kirchmaier. In Niederösterreich und besonders im Waldviertel spielt die traditionelle Karpfenteichwirtschaft eine große Rolle und hat eine ähnlich lange Tradition wie in Bayern. Leider sind auch die Probleme der Waldviertler Teichwirtschaft mit den Herausforderungen im Landkreis Tirschenreuth vergleichbar.
Während des Besuchs wurden die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit und Kooperation zwischen dem Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth und dem Waldviertel Teichwirteverband eruiert. Einen intensiven Austausch gab es vor allem zur Fischotterproblematik, aber auch beim Ausloten der Möglichkeiten, sich als Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS ) zu bewerben. Im Bericht zur Bio-Karpfenproduktion ging Leo Kirchmaier auf die Konsumgewohnheiten der Österreicher ein, die im EU-Vergleich mehr Wert auf die Qualität und regionale Herkunft der Lebensmittel legen.
Der Höhepunkt des Besuchs war die öffentliche Vortrags- und Diskussionsveranstaltung, an der viele Teichwirte, Vertreter der Berufsverbände (u.a. VDBA und Young Fishermen) und Interessierte aus der Oberpfalz und Oberfranken teilnahmen. Nach der Begrüßung durch Landrat Roland Grillmeier schilderte Leo Kirchmaier die Ausgangslage für die Teichwirtschaft in seiner Heimat. So ist dort zum Beispiel die Entnahme von Fischottern bereits möglich, wobei sie allerdings mit viel Bürokratie und Aufwand verbunden ist. Nach der Erläuterung der Lösungsansätze der Fischotterproblematik in Niederösterreich fand ein ausführlicher Meinungs- und Erfahrungsaustausch statt. Wie erwartet, kamen dabei zahlreiche frustrierende Beispiele aus der heimischen Teichwirtschaft auf den Tisch. Die Teilnehmenden appellierten an die Politik endlich den hohen Wert der traditionellen Teichwirtschaft anzuerkennen und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dieses „Immaterielle Kulturerbe“ weiterbestehen kann.
Den Bericht über die Erfahrungen der Bio-Karpfenproduktion in Waldviertel und die Beantragung als GIAHS verfolgten die Zuhörenden mit großem Interesse. Aus dem intensiven Meinungs- und Ideenaustausch ging der Vorschlag hervor, Waldviertel in Niederösterreich zum Zielgebiet der nächsten Fischereilehrfahrt zu machen.
„Die traditionelle Teichwirtschaft, die Zisterzienser und viele weitere Gemeinsamkeiten verbinden das Waldviertel und den Landkreis Tirschenreuth. Arbeiten wir zusammen um unsere Traditionen zu erhalten. “ – so schloss der Moderator der Podiumsdiskussion Hans Klupp die Veranstaltung ab.
Quelle: erlebnis-fisch.de
Während des Besuchs wurden die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit und Kooperation zwischen dem Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth und dem Waldviertel Teichwirteverband eruiert. Einen intensiven Austausch gab es vor allem zur Fischotterproblematik, aber auch beim Ausloten der Möglichkeiten, sich als Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS ) zu bewerben. Im Bericht zur Bio-Karpfenproduktion ging Leo Kirchmaier auf die Konsumgewohnheiten der Österreicher ein, die im EU-Vergleich mehr Wert auf die Qualität und regionale Herkunft der Lebensmittel legen.
Der Höhepunkt des Besuchs war die öffentliche Vortrags- und Diskussionsveranstaltung, an der viele Teichwirte, Vertreter der Berufsverbände (u.a. VDBA und Young Fishermen) und Interessierte aus der Oberpfalz und Oberfranken teilnahmen. Nach der Begrüßung durch Landrat Roland Grillmeier schilderte Leo Kirchmaier die Ausgangslage für die Teichwirtschaft in seiner Heimat. So ist dort zum Beispiel die Entnahme von Fischottern bereits möglich, wobei sie allerdings mit viel Bürokratie und Aufwand verbunden ist. Nach der Erläuterung der Lösungsansätze der Fischotterproblematik in Niederösterreich fand ein ausführlicher Meinungs- und Erfahrungsaustausch statt. Wie erwartet, kamen dabei zahlreiche frustrierende Beispiele aus der heimischen Teichwirtschaft auf den Tisch. Die Teilnehmenden appellierten an die Politik endlich den hohen Wert der traditionellen Teichwirtschaft anzuerkennen und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dieses „Immaterielle Kulturerbe“ weiterbestehen kann.
Den Bericht über die Erfahrungen der Bio-Karpfenproduktion in Waldviertel und die Beantragung als GIAHS verfolgten die Zuhörenden mit großem Interesse. Aus dem intensiven Meinungs- und Ideenaustausch ging der Vorschlag hervor, Waldviertel in Niederösterreich zum Zielgebiet der nächsten Fischereilehrfahrt zu machen.
„Die traditionelle Teichwirtschaft, die Zisterzienser und viele weitere Gemeinsamkeiten verbinden das Waldviertel und den Landkreis Tirschenreuth. Arbeiten wir zusammen um unsere Traditionen zu erhalten. “ – so schloss der Moderator der Podiumsdiskussion Hans Klupp die Veranstaltung ab.
Quelle: erlebnis-fisch.de
15.07.2024
Präsident des VDBA zu Gast an der Küste
Der Präsident des Verbandes der Deutschen Binnenfischerei und Aquakultur, Bernhard Feneis, weilte im April zu seinem Jahresurlaub an der Ostseeküste. Da er in seiner Funktion als Präsidenten der Working Party on Fish bei COPA*COGECA auch des Öfteren die Küstenfischerei in Brüssel vertreten muss, ließ er es sich nehmen, sich die Fischerei an der Mecklenburg-Vorpommerschen Küste einmal genauer anzusehen. Er wurde in Freest vom dortigen Geschäftsführer Michael Schütt herzlich empfangen. Herr Schütt erklärte ihm die Fischereistrukturen in M-V, die Entwicklungen der Fischerei in den letzten Jahrzehnten sowie die Bestandsentwicklungen der wirtschaftlich wichtigsten Fischarten und die daraus resultierenden, drastischen Quotenkürzungen der letzten Jahre. Normalerweise sind die Fischer zu
dieser Jahreszeit voll in der Heringssaison aktiv. Durch die massiven Quotenkürzungen der letzten Jahre war es in diesem Jahr allerdings sehr ruhig. Die meisten Fischer haben beim Besuch von Herrn Feneis gerade die Möglichkeit der befristeten Stilllegung in Anspruch genommen, sodass ein direkter Austausch mit den Fischern leider nicht möglich war. Trotzdem war es für beide Seiten ein sehr offener Austausch, bei dem viele Gemeinsamkeiten, beispielsweise beim Thema Prädatoren, entdeckt und diskutiert wurden. Man verständigte sich darauf, auch weiterhin einen losen Austausch bei gemeinsamen Themen zu pflegen.
Quelle: Zeitschrift "Fischerei und Fischmarkt" in M-V 2/2024
dieser Jahreszeit voll in der Heringssaison aktiv. Durch die massiven Quotenkürzungen der letzten Jahre war es in diesem Jahr allerdings sehr ruhig. Die meisten Fischer haben beim Besuch von Herrn Feneis gerade die Möglichkeit der befristeten Stilllegung in Anspruch genommen, sodass ein direkter Austausch mit den Fischern leider nicht möglich war. Trotzdem war es für beide Seiten ein sehr offener Austausch, bei dem viele Gemeinsamkeiten, beispielsweise beim Thema Prädatoren, entdeckt und diskutiert wurden. Man verständigte sich darauf, auch weiterhin einen losen Austausch bei gemeinsamen Themen zu pflegen.
Quelle: Zeitschrift "Fischerei und Fischmarkt" in M-V 2/2024
24.03.2024
Carpy Podacst spendet an die Young Fishermen
Die Podacster Maurice Kaulbach, Marian Sura und Peter Schwedes haben in ihrem "Carpy" Podacst die Angelruten von Peter verlost. Der Gewinn aus den Losen wurde an die Young Fishermen gespendet. Insgesamt kamen über 6.000 Euro zusammen. Diese großzügige Spende ermöglicht den Nachwuchs der Aquaklultubranche auch weiterhin die Zukunft der Branche mitzugestalten.
Wir sagen Danke!
Wir sagen Danke!
24.03.2024
Young Fishermen zu Gast beim Carpy Podcast
Die Jungs vom Carpy Podcast haben die "Young Fishermen" großzügig unterstützt. Als Dank dafür hospitiert Anna Klupp in der aktuellen Folge des Carpy Podacst.
Hört gerne rein!
Carpy - der „einfach geil angeln" Podcast (letscast.fm)
Hört gerne rein!
Carpy - der „einfach geil angeln" Podcast (letscast.fm)
22.03.2024
Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick zu Gast bei den Young Fishermen
Am 08.03.2024 besuchte die Grünen-Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Dr. Ophelia Nick den Landkreis Tirschenreuth, um sich ein genaueres Bild von der Teichwirtschaft vor Ort sowie einerseits über die regionalen als auch überregional Themen der Teichwirte zu informieren. Begleitet wurde Sie durch die Oberpfälzer Bundestagsabgeordnete Tina Winklmann und die Landtagsabgeordnete Laura Weber. Ebenso waren die B90/ Die Grünen Ortsgruppen Tirschenreuth und Schwandorf vertreten.
Der Termin begann am Kornthaner Weiher, wo Herr Stephan Stock vom ansässigen Fischereibetrieb Stock einen umfassenden Einblick in die jahrhundertealte Tradition der Teichwirtschaft gab. Dabei wurden nicht nur die Entstehungsgeschichte dieser Praxis in der Region, insbesondere in Kornthan, beleuchtet, sondern auch die arbeitsintensive und zeitaufwändige Aufzucht des beliebten Speisefisches von mindestens 3 Jahren sowie das ideale Platzangebot für die Karpfen in den weitläufigen Teichen im Sinne einer extensiven Bewirtschaftung erläutert. Ophelia Nick würdigte diese Bemühungen mit anerkennenden Worten.
Bei einer anschließenden Ortsbegehung durch das Gebiet um den Wirlerteich bei Muckenthal wurde die Relevanz der Teichgebiete für den zunehmend wichtigen Wasserrückhalt in der Landschaft sowie deren Rolle als Biotopflächen deutlich. Unter der fachkundigen Führung von Lena Bächer, Mitglied der YFM und selbst engagierte Teichwirtin, wurden die vielfältigen Ökosystemdienstleistungen der Teiche hervorgehoben. Diese umfassen unter anderem die Schaffung wertvoller Habitate für Insekten und Amphibien, den Wasserrückhalt und den Sediment- und Nährstoffrückhalt. Besorgniserregend ist jedoch die Tendenz, dass im letzten Jahrhundert 50 bis 90 % der Teichflächen in europäischen Ländern verloren gegangen sind. Ein Resultat der zahlreichen Problemstellungen, die sich die Karpfenteichwirtschaft gegenübersieht. Es wurde betont, dass gerade durch die traditionell extensive Bewirtschaftung der Teiche eine Biodiversität erhalten bleibt, die seltenen Arten wie dem Moorfrosch ein geeignetes Biotop bietet. Ein offenes Gespräch verdeutlichte die Folgen, wenn Teichflächen nicht mehr bewirtschaftet werden und wertvolle Biotopflächen verloren gehen.
Die YFM verdeutlichten die Dringlichkeit für eine Regionalisierung der Schutzbestimmungen bestimmter Prädatoren. Es wurde betont, dass bis zur Herstellung eines bundesweit guten Erhaltungszustands des Fischotters, weitere Teichwirte aufgeben und weitere Teichflächen verloren gehen werden. Untersuchungen der Universität Graz zeigen deutlich, dass innerhalb von Teichgebieten unnatürlich hohe Fischotterbestände vorkommen.
Die Politik bzw. die Gesellschaft muss im Einklang mit der Teichwirtschaft die Entscheidung treffen, ob Teiche mit all ihren Ökosystemdienstleistungen erhalten werden sollen oder ob die Teichwirtschaft für den Schutz einer Art geopfert wird. Ein fischfreier Teich führt zur Verschlechterung des ökologischen Zustands und wird verlanden.
Die Schäden der immer noch ungeregelten Prädationsproblematik tragen hauptsächlich die Teichwirte. Ein wirtschaftlicher Ertrag ist ein Muss für die zukünftige Weiterbewirtschaftung.
Im weiteren Verlauf des Gespräches und inspiriert durch die Fischköstlichkeiten des Fischstüberl Bächer, wurde die Bedeutung des Karpfens als regionales und nachhaltiges Lebensmittel verdeutlicht. Bis 2030 sollen in Deutschland 30 % der Flächen biologisch bewirtschaftet werden. Bei der Karpfenteichwirtschaft sind momentan circa 1 % der Betriebe als Bio gekennzeichnet. Ein Flaschenhals für eine zukunftsorientierte Ausrichtung der Karpfenteichwirtschaft spielt dabei die Verfügbarkeit von bio-zertifizierten Setzlingen. Hier muss auf EU-Ebene auf eine Ausnahmegenehmigung hingewirkt werden, damit konventionelle Setzlinge genutzt werden können. Diese muss so lange gelten bis ausreichend Bio-Setzlinge vorhanden sind. Ist diese Engstelle überwunden, so kann man die Karpfenteichwirtschaft ohne Probleme auf eine ökologische Bewirtschaftung umstellen. Bei der Förderung sollte man sich an anderen Dauerkulturen (z.B. Heidelbeere) orientieren.
Ophelia Nick betonte die zentrale Rolle der Außerhausverpflegung durch Mensen und Kantinen und forderte eine Erhöhung des Anteils regionaler und ökologischer Erzeugnisse bis 2025. Dies könnte zu Multiplikationseffekten für andere Lebensmittelbranchen führen und die Bereitschaft der Gesellschaft fördern, regionale, nachhaltige und ökologische Produkte zu konsumieren.
Abschließend wurde das kürzlich beschlossene europäische Nature Restoration Law diskutiert und dessen potenzielle Auswirkungen auf die Teichwirtschaft und FFH-Gebiete erörtert. Die Befürchtung besteht, dass bestehende FFH-Gebiete aus der Bewirtschaftung genommen werden müssten, was dem Erhalt der Biotopflächen entgegensteht.
Der Besuch von Ophelia Nick war geprägt von einem fachlich fundierten Austausch und einem gemeinsamen Interesse, die Teichwirtschaft in ihrer jetzigen Form zu erhalten. Es bedarf praxisnaher, fachlich neutraler und regional spezifischer Lösungsansätze, um den zahlreichen Herausforderungen der Branche zu begegnen und Zielkonflikte auf neutrale Weise zu diskutieren und zu lösen. Die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung der Teichwirtschaft spielen dabei eine fundamentale Rolle und beeinflussen die Bereitschaft junger Teichwirte, bestehende Betriebe zu übernehmen oder neue zu gründen.
Der Termin begann am Kornthaner Weiher, wo Herr Stephan Stock vom ansässigen Fischereibetrieb Stock einen umfassenden Einblick in die jahrhundertealte Tradition der Teichwirtschaft gab. Dabei wurden nicht nur die Entstehungsgeschichte dieser Praxis in der Region, insbesondere in Kornthan, beleuchtet, sondern auch die arbeitsintensive und zeitaufwändige Aufzucht des beliebten Speisefisches von mindestens 3 Jahren sowie das ideale Platzangebot für die Karpfen in den weitläufigen Teichen im Sinne einer extensiven Bewirtschaftung erläutert. Ophelia Nick würdigte diese Bemühungen mit anerkennenden Worten.
Bei einer anschließenden Ortsbegehung durch das Gebiet um den Wirlerteich bei Muckenthal wurde die Relevanz der Teichgebiete für den zunehmend wichtigen Wasserrückhalt in der Landschaft sowie deren Rolle als Biotopflächen deutlich. Unter der fachkundigen Führung von Lena Bächer, Mitglied der YFM und selbst engagierte Teichwirtin, wurden die vielfältigen Ökosystemdienstleistungen der Teiche hervorgehoben. Diese umfassen unter anderem die Schaffung wertvoller Habitate für Insekten und Amphibien, den Wasserrückhalt und den Sediment- und Nährstoffrückhalt. Besorgniserregend ist jedoch die Tendenz, dass im letzten Jahrhundert 50 bis 90 % der Teichflächen in europäischen Ländern verloren gegangen sind. Ein Resultat der zahlreichen Problemstellungen, die sich die Karpfenteichwirtschaft gegenübersieht. Es wurde betont, dass gerade durch die traditionell extensive Bewirtschaftung der Teiche eine Biodiversität erhalten bleibt, die seltenen Arten wie dem Moorfrosch ein geeignetes Biotop bietet. Ein offenes Gespräch verdeutlichte die Folgen, wenn Teichflächen nicht mehr bewirtschaftet werden und wertvolle Biotopflächen verloren gehen.
Die YFM verdeutlichten die Dringlichkeit für eine Regionalisierung der Schutzbestimmungen bestimmter Prädatoren. Es wurde betont, dass bis zur Herstellung eines bundesweit guten Erhaltungszustands des Fischotters, weitere Teichwirte aufgeben und weitere Teichflächen verloren gehen werden. Untersuchungen der Universität Graz zeigen deutlich, dass innerhalb von Teichgebieten unnatürlich hohe Fischotterbestände vorkommen.
Die Politik bzw. die Gesellschaft muss im Einklang mit der Teichwirtschaft die Entscheidung treffen, ob Teiche mit all ihren Ökosystemdienstleistungen erhalten werden sollen oder ob die Teichwirtschaft für den Schutz einer Art geopfert wird. Ein fischfreier Teich führt zur Verschlechterung des ökologischen Zustands und wird verlanden.
Die Schäden der immer noch ungeregelten Prädationsproblematik tragen hauptsächlich die Teichwirte. Ein wirtschaftlicher Ertrag ist ein Muss für die zukünftige Weiterbewirtschaftung.
Im weiteren Verlauf des Gespräches und inspiriert durch die Fischköstlichkeiten des Fischstüberl Bächer, wurde die Bedeutung des Karpfens als regionales und nachhaltiges Lebensmittel verdeutlicht. Bis 2030 sollen in Deutschland 30 % der Flächen biologisch bewirtschaftet werden. Bei der Karpfenteichwirtschaft sind momentan circa 1 % der Betriebe als Bio gekennzeichnet. Ein Flaschenhals für eine zukunftsorientierte Ausrichtung der Karpfenteichwirtschaft spielt dabei die Verfügbarkeit von bio-zertifizierten Setzlingen. Hier muss auf EU-Ebene auf eine Ausnahmegenehmigung hingewirkt werden, damit konventionelle Setzlinge genutzt werden können. Diese muss so lange gelten bis ausreichend Bio-Setzlinge vorhanden sind. Ist diese Engstelle überwunden, so kann man die Karpfenteichwirtschaft ohne Probleme auf eine ökologische Bewirtschaftung umstellen. Bei der Förderung sollte man sich an anderen Dauerkulturen (z.B. Heidelbeere) orientieren.
Ophelia Nick betonte die zentrale Rolle der Außerhausverpflegung durch Mensen und Kantinen und forderte eine Erhöhung des Anteils regionaler und ökologischer Erzeugnisse bis 2025. Dies könnte zu Multiplikationseffekten für andere Lebensmittelbranchen führen und die Bereitschaft der Gesellschaft fördern, regionale, nachhaltige und ökologische Produkte zu konsumieren.
Abschließend wurde das kürzlich beschlossene europäische Nature Restoration Law diskutiert und dessen potenzielle Auswirkungen auf die Teichwirtschaft und FFH-Gebiete erörtert. Die Befürchtung besteht, dass bestehende FFH-Gebiete aus der Bewirtschaftung genommen werden müssten, was dem Erhalt der Biotopflächen entgegensteht.
Der Besuch von Ophelia Nick war geprägt von einem fachlich fundierten Austausch und einem gemeinsamen Interesse, die Teichwirtschaft in ihrer jetzigen Form zu erhalten. Es bedarf praxisnaher, fachlich neutraler und regional spezifischer Lösungsansätze, um den zahlreichen Herausforderungen der Branche zu begegnen und Zielkonflikte auf neutrale Weise zu diskutieren und zu lösen. Die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung der Teichwirtschaft spielen dabei eine fundamentale Rolle und beeinflussen die Bereitschaft junger Teichwirte, bestehende Betriebe zu übernehmen oder neue zu gründen.
22.03.2024
Young Fishermen auf der Fisch international in Bremen
Ziele der Young Fishermen sind unter anderem die internationale Vernetzung mit Kolleg/innen und die Fortbildung auf dem Gebiet der Fischerei und Aquakultur. Daher veranstalteten wir im Februar 2024 eine Exkursion zur Fisch International nach Bremen. Zu acht startete unsere Reise im ICE ab Nürnberg. Am Vorabend der Messe wurde zusammen die Bremer Altstadt erkundet.
Auf der Fish International Messe in Bremen wurde ein umfassendes Programm unter dem Motto "Responsible" präsentiert, das sich auf drei Hauptthemen konzentrierte: Lebensmittelproduktion, Nachhaltigkeit und Transparenz. Ziel dieser Themenwahl ist die Förderung eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Ansatzes bei der Produktion und dem Konsum von Fisch und Meeresfrüchten.
Die Besucher hatten dabei die Möglichkeit, die enorme thematische Vielfalt aller Stände zu erkunden, sich fachspezifisch auszutauschen und innovative Produkte zu entdecken. Ganz klarer Trend in diesem Jahr waren pflanzliche Fischersatzprodukte. Hier zu nennen sind BettaF!sh mit ihrem Thunfischersatz auf Algenbasis oder TasteLike mit veganen Fischbrötchen. Das vielfältige Rahmenprogramm bot Vorträge, Best Practices und Diskussionen zu zukunftsweisenden Schlüsselthemen der Branche, wie beispielsweise die Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Aquakultur.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Messe war der interne Branchenaustausch und das persönliche Gespräch, um Netzwerke auszubauen, Inspiration zu finden und aktuelle Trends und Entwicklungen zu verfolgen.
Auf der Messe waren insgesamt 321 Aussteller vertreten. Dabei haben wir Binnenfischer/innen einige bekannte Gesichter getroffen, wie z.B. die Vertreter von Alltech Coppens oder die Inhaber von Water-proved.
Da wir aber auf der Messe waren, um Neues zu entdecken stellen wir die Aussteller, die uns besonders im Gedächtnis geblieben sind, kurz vor.
Hans Hausmann
Die litauische Firma Išlauzo Zuvis hat mit ihrem Messestand gezeigt, wie vielfältig, geschmackvoll und modern das Produkt Karpfen sein kann. Im geneinsamen Austausch konnten wir Unterschiede und Gemeinsamkeiten innerhalb der Vermarktung und Verarbeitung vergleichen. Dies hat unseren Horizont wachsen und neue Ideen für die heimischen Karpfenbetrieb reifen lassen. Das Probieren der kulinarische Produktpalette hat dazu mitunter eindrucksvoll beigetragen.
Tanja Knutzen und Max Brönner
4DimBlick erstellt VR-Lerninhalte für die "Aquaculture Welfare Standards Initiative". Diese konnten an deren Kombi-Stand erlebt werden! Touren gehen über Themen wie
Betäubung und Schlachtung von Karpfen und Forelle, Wasserqualität, betriebliche Eigenkontrolle oder auch ein virtueller Rundgang auf der Forellenfarm Rameil. Diese Inhalte werden aufgearbeitet in Form von Multiple-Choice-Quiz-Fragen, Suchaufträgen in virtuellen Räumen und ähnlichem.
Besonders spannend war Farm to fork, irischer Biolachs, bei der der Weg des Fisches (Unterwasser aus dem Netzgehege bis hin zur Räucherei Klein Meckelsen), da es sich hierbei um Eindrücke handelt, die man sonst nirgends bekommt!
Besonders interessant war das Kieler Start-Up Unternehmen 4DimBlick, welches sich auf die Entwicklung VR-gestützter immersiver Lernmodule für Schulen und Fachausbildungen spezialisiert hat. Interessierte Messebesucher konnten hier mithilfe von VR-Brillen „eintauchen“ in eine realitätsnahe Lernumgebung und beispielsweise mehr über. Vorteile dieser Art von Wissensvermittlung sind unteranderem, dass unzugängliche oder gefährliche Umgebungen zugänglich werden, Lerninhalte didaktisch angereichert und einem breiten Publikum, aber auch Fachpersonal, zu Verfügung gestellt werden können. Auch Unterwasserprozesse lassen sich somit darstellen und virtuell erleben.
Anna Klupp
Seawater Cubes ist ein Start Up aus dem Saarland. Das seit 2018 bestehende Unternehmen vermarktet kompakte Kreislaufanlagen. In drei miteinander verbundenen Schiffscontainern sollen zukünftig Meeresfische dezentral erzeugt werden. In den volltechnisierten Anlagen sollen ca. 7 Tonnen Fisch jährlich erzeugt werden können, bei einem Arbeitsaufwand von nur durchschnittlich einer Stunde am Tag. Die Anlage eignet sich für Salzwasserfische, die in warmem Wasser aufwachsen und nicht allzu groß werden. Dazu gehören z.B. Wolfsbarsch, Dorade, Yellowtail Kingfish, Red Snapper oder Grouper. In Anbetracht des Energiebedarfs kommt die Anlage eigentlich nur für Betreiber von Biogas- oder PV-Anlagen in Betracht. Auch die Vermarktung der erzeugten Fische kann schwierig sein. Hier werden für den Fisch aus dem Cube wesentlich höhere Preise aufgerufen (seawaterfish.de) als für vergleichbare Ware aus maritimer Aquakultur. Aktuell baut die Firma die zweite Anlage. Die Zeit wird zeigen, ob die Seawatercubes tatsächlich zur dezentralen Versorgung mit Meeresfisch beitragen können oder ob es sich mehr um Bauernfängerei handelt.
Isabell Schwegel
Unsere Reise zur fishinternational nach Bremen hat meine persönlichen Erwartungen weit überstiegen! Nachdem ich im Februar 2020 das erste mal die fishinternational in Bremen besucht habe und bereits damals von den Einblicken in die verschiedensten Bereiche begeistert war, freute ich mich, dass der Vorschlag einer gemeinsamen Reise so gut angenommen worden ist. Der direkte Austausch mit Firmen der Aquakultur, Einblick in neue Systeme und in die Vielfalt der vorhandenen Produktpaletten waren bereichernd und interessant. Die verschiedenen Bereiche, Gastronomie, Verarbeitung und Aquakultur konnten neue Inspirationen mit in den Alltag der Fischerei bringen.
So war ich auf der Suche nach einem Sauerstoffmessgerät mit optischer Sonde, die Namhaften Hersteller WTW und Hach dürften jedem geläufig sein, recht neu auf dem Markt ist das Sauerstoffmessgerät NEON Optod der Firma Aqualabo aus Frankreich. Im Bereich der fest installierten Sauerstoffüberwachung verfügt die Firma Aqualabo bereits über eine jahrelange Erfahrung, sodass sie nun ihre Produktpalette auf die manuelle Sauerstoffmessung erweitert hat. Der Deutsche Vertriebspartner WaterProved hat das Gerät zu einem unschlagbaren Messepreis angeboten.
Eine elegante und komfortable Lösung der Fütterung bietet AquaSyster. Die Futterautomaten erinnern an das Erscheinungsbild weit verbreiteter Automaten in fischereilichen Betrieben, doch können sie mit einem Edelstahlgehäuse glänzen und die Steuerung ist manuell und via Smartphone bedienbar. Für größere Einheiten werden Futterautomaten mit 800 kg und 1500 kg angeboten, welche mehrere Abgänge aufweisen und somit eine flexible Alternative zur automatischen Fütterung bietet.
Danksagung
Ein besonderer Dank geht an den Verband der Bayerischen Berufsfischer (VBB), welcher uns die Unterkunft vor Ort ermöglichte, die fishinternational, welche uns eine spannende und erlebnisreiche Messe geboten hat und uns den Eintritt erlassen hat und an all die bekannten Berufskolleg*innen die den Besuch in Bremen bereichert haben. Die Fahrt zur Fisch international hat dazu beigetragen den Zusammenhalt unserer Gruppe zu stärken und hat uns viele neue Eindrücke gewinnen lassen. Noch mehr als zuvor können wir sagen, dass die gemeinsame Passion für die Fischerei uns verbindet.
Auf der Fish International Messe in Bremen wurde ein umfassendes Programm unter dem Motto "Responsible" präsentiert, das sich auf drei Hauptthemen konzentrierte: Lebensmittelproduktion, Nachhaltigkeit und Transparenz. Ziel dieser Themenwahl ist die Förderung eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Ansatzes bei der Produktion und dem Konsum von Fisch und Meeresfrüchten.
Die Besucher hatten dabei die Möglichkeit, die enorme thematische Vielfalt aller Stände zu erkunden, sich fachspezifisch auszutauschen und innovative Produkte zu entdecken. Ganz klarer Trend in diesem Jahr waren pflanzliche Fischersatzprodukte. Hier zu nennen sind BettaF!sh mit ihrem Thunfischersatz auf Algenbasis oder TasteLike mit veganen Fischbrötchen. Das vielfältige Rahmenprogramm bot Vorträge, Best Practices und Diskussionen zu zukunftsweisenden Schlüsselthemen der Branche, wie beispielsweise die Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Aquakultur.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Messe war der interne Branchenaustausch und das persönliche Gespräch, um Netzwerke auszubauen, Inspiration zu finden und aktuelle Trends und Entwicklungen zu verfolgen.
Auf der Messe waren insgesamt 321 Aussteller vertreten. Dabei haben wir Binnenfischer/innen einige bekannte Gesichter getroffen, wie z.B. die Vertreter von Alltech Coppens oder die Inhaber von Water-proved.
Da wir aber auf der Messe waren, um Neues zu entdecken stellen wir die Aussteller, die uns besonders im Gedächtnis geblieben sind, kurz vor.
Hans Hausmann
Die litauische Firma Išlauzo Zuvis hat mit ihrem Messestand gezeigt, wie vielfältig, geschmackvoll und modern das Produkt Karpfen sein kann. Im geneinsamen Austausch konnten wir Unterschiede und Gemeinsamkeiten innerhalb der Vermarktung und Verarbeitung vergleichen. Dies hat unseren Horizont wachsen und neue Ideen für die heimischen Karpfenbetrieb reifen lassen. Das Probieren der kulinarische Produktpalette hat dazu mitunter eindrucksvoll beigetragen.
Tanja Knutzen und Max Brönner
4DimBlick erstellt VR-Lerninhalte für die "Aquaculture Welfare Standards Initiative". Diese konnten an deren Kombi-Stand erlebt werden! Touren gehen über Themen wie
Betäubung und Schlachtung von Karpfen und Forelle, Wasserqualität, betriebliche Eigenkontrolle oder auch ein virtueller Rundgang auf der Forellenfarm Rameil. Diese Inhalte werden aufgearbeitet in Form von Multiple-Choice-Quiz-Fragen, Suchaufträgen in virtuellen Räumen und ähnlichem.
Besonders spannend war Farm to fork, irischer Biolachs, bei der der Weg des Fisches (Unterwasser aus dem Netzgehege bis hin zur Räucherei Klein Meckelsen), da es sich hierbei um Eindrücke handelt, die man sonst nirgends bekommt!
Besonders interessant war das Kieler Start-Up Unternehmen 4DimBlick, welches sich auf die Entwicklung VR-gestützter immersiver Lernmodule für Schulen und Fachausbildungen spezialisiert hat. Interessierte Messebesucher konnten hier mithilfe von VR-Brillen „eintauchen“ in eine realitätsnahe Lernumgebung und beispielsweise mehr über. Vorteile dieser Art von Wissensvermittlung sind unteranderem, dass unzugängliche oder gefährliche Umgebungen zugänglich werden, Lerninhalte didaktisch angereichert und einem breiten Publikum, aber auch Fachpersonal, zu Verfügung gestellt werden können. Auch Unterwasserprozesse lassen sich somit darstellen und virtuell erleben.
Anna Klupp
Seawater Cubes ist ein Start Up aus dem Saarland. Das seit 2018 bestehende Unternehmen vermarktet kompakte Kreislaufanlagen. In drei miteinander verbundenen Schiffscontainern sollen zukünftig Meeresfische dezentral erzeugt werden. In den volltechnisierten Anlagen sollen ca. 7 Tonnen Fisch jährlich erzeugt werden können, bei einem Arbeitsaufwand von nur durchschnittlich einer Stunde am Tag. Die Anlage eignet sich für Salzwasserfische, die in warmem Wasser aufwachsen und nicht allzu groß werden. Dazu gehören z.B. Wolfsbarsch, Dorade, Yellowtail Kingfish, Red Snapper oder Grouper. In Anbetracht des Energiebedarfs kommt die Anlage eigentlich nur für Betreiber von Biogas- oder PV-Anlagen in Betracht. Auch die Vermarktung der erzeugten Fische kann schwierig sein. Hier werden für den Fisch aus dem Cube wesentlich höhere Preise aufgerufen (seawaterfish.de) als für vergleichbare Ware aus maritimer Aquakultur. Aktuell baut die Firma die zweite Anlage. Die Zeit wird zeigen, ob die Seawatercubes tatsächlich zur dezentralen Versorgung mit Meeresfisch beitragen können oder ob es sich mehr um Bauernfängerei handelt.
Isabell Schwegel
Unsere Reise zur fishinternational nach Bremen hat meine persönlichen Erwartungen weit überstiegen! Nachdem ich im Februar 2020 das erste mal die fishinternational in Bremen besucht habe und bereits damals von den Einblicken in die verschiedensten Bereiche begeistert war, freute ich mich, dass der Vorschlag einer gemeinsamen Reise so gut angenommen worden ist. Der direkte Austausch mit Firmen der Aquakultur, Einblick in neue Systeme und in die Vielfalt der vorhandenen Produktpaletten waren bereichernd und interessant. Die verschiedenen Bereiche, Gastronomie, Verarbeitung und Aquakultur konnten neue Inspirationen mit in den Alltag der Fischerei bringen.
So war ich auf der Suche nach einem Sauerstoffmessgerät mit optischer Sonde, die Namhaften Hersteller WTW und Hach dürften jedem geläufig sein, recht neu auf dem Markt ist das Sauerstoffmessgerät NEON Optod der Firma Aqualabo aus Frankreich. Im Bereich der fest installierten Sauerstoffüberwachung verfügt die Firma Aqualabo bereits über eine jahrelange Erfahrung, sodass sie nun ihre Produktpalette auf die manuelle Sauerstoffmessung erweitert hat. Der Deutsche Vertriebspartner WaterProved hat das Gerät zu einem unschlagbaren Messepreis angeboten.
Eine elegante und komfortable Lösung der Fütterung bietet AquaSyster. Die Futterautomaten erinnern an das Erscheinungsbild weit verbreiteter Automaten in fischereilichen Betrieben, doch können sie mit einem Edelstahlgehäuse glänzen und die Steuerung ist manuell und via Smartphone bedienbar. Für größere Einheiten werden Futterautomaten mit 800 kg und 1500 kg angeboten, welche mehrere Abgänge aufweisen und somit eine flexible Alternative zur automatischen Fütterung bietet.
Danksagung
Ein besonderer Dank geht an den Verband der Bayerischen Berufsfischer (VBB), welcher uns die Unterkunft vor Ort ermöglichte, die fishinternational, welche uns eine spannende und erlebnisreiche Messe geboten hat und uns den Eintritt erlassen hat und an all die bekannten Berufskolleg*innen die den Besuch in Bremen bereichert haben. Die Fahrt zur Fisch international hat dazu beigetragen den Zusammenhalt unserer Gruppe zu stärken und hat uns viele neue Eindrücke gewinnen lassen. Noch mehr als zuvor können wir sagen, dass die gemeinsame Passion für die Fischerei uns verbindet.
28.02.2024
Psychische Not der Landwirte, der unsichtbare Grund für Ihre Proteste
Die Proteste der Landwirte in ganz Europa sind in diesen Tagen in den Schlagzeilen, mit Hunderten von Traktoren, die den Verkehr in den europäischen Großstädten blockieren, erschöpft von jahrelanger Politik, dieihre Arbeit untergraben hat. Aber es gibt einen weniger bekannten Grund für eine solche Aktion. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich der Druck auf die Landwirte im Laufe der Jahre auch erheblich negativ auf ihre Gesundheit und ihr psychisches Wohlbefinden ausgewirkt hat. Das ist sehr besorgniserregend, aber völlig verständlich. In vielen Fällen ist ihre tägliche Arbeit eine Tätigkeit, die über Generationen weitergegeben wurde, und das Risiko des Scheiterns verursacht neben den unzähligen Schwierigkeiten, mit denen die Branche in letzter Zeit zu kämpfen hat, eine Menge psychischer Belastungen.
Die landwirtschaftlichen Betriebe gehören diesen Familien seit Generationen, aber die europäische Politik tut oft wenig, um ihre Einkommen zu schützen, was zu finanzieller Unsicherheit führt und viele landwirtschaftliche Betriebe zur Schließung zwingt. Die Situation ist dramatischer, als man denkt. Eine Umfrage aus dem Jahr 2023 unter mehr als 250 irischen Landwirten ergab, dass 20 % in den letzten zwei Wochen über Selbstmord nachgedacht hatten, während fast 40 % von mäßigem bis extrem hohem Stress berichteten. In Nordbelgien gab fast die Hälfte der 600 befragten Landwirte an, dass ihre Arbeit eine Ursache für psychische Belastungen sei. Mehr als ein Viertel der deutschen und österreichischen Bauern gab an, an Burnout zu leiden, doppelt so viele wie in der Allgemeinbevölkerung.
Das Gefühl der Ohnmacht, Unterdrückung und Ungerechtigkeit kann unerträglich sein
Landwirte berichten, dass sie sich von der Klimapolitik, die sie zu Unrecht als die größten Umweltverschmutzer des Planeten bezeichnet, völlig erdrückt fühlen. Der Anstieg der Kosten, der Rückgang der Verkaufspreise und die allzu starren und unfairen Regeln für ihre Arbeit schädigen unweigerlich auch ihre psychische Gesundheit. Das Gefühl der Ohnmacht, Unterdrückung und Ungerechtigkeit soll für viele unerträglich geworden sein, angesichts der Schlagzeilen, die den Agrarsektor als Hauptursache für die globale Erwärmung und den Verlust der biologischen Vielfalt darstellen. Die Landwirtschaft weiß, wie viele andere Sektoren auch, dass sie die Auswirkungen auf die Umwelt verringern muss. In dieser Hinsicht hat die Nutztierhaltung Erfolge bei der Reduzierung von Emissionen gezeigt. Diese Verbesserungen sollten jedoch nicht dadurch untergraben werden, dass ihre Arbeit unmöglich gemacht wird. Schließlich sind es die Bauern, die die Lebensmittel in unsere Supermarktregale bringen.
Landwirte stehen an vorderster Front im Kampf gegen den Klimawandel
Die Landwirte stehen im Kampf gegen den Klimawandel an vorderster Front und gehören auch zu den am stärksten davon Betroffenen. Aber der untragbare Anstieg der Kosten, die immer strengeren Vorschriften für Emissionen und die Beschränkungen der Verwendung verschiedener Betriebsmittel, negative Darstellungen in den Medien und die Streichung von Subventionen für landwirtschaftliche Brennstoffe haben jeden Respekt vor ihrer grundlegenden Rolle als Hüter des Landes und Lieferanten von Lebensmitteln untergraben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Bauern aufgefordert, alles zu geben, um den Hunger zu beenden und unsere Lebensmittelversorgung zu sichern. Heute werden sie jedoch ständig kritisiert und als Umweltverschmutzer und Quäler von Tieren abgestempelt. Diese Art von ständiger Kritik wäre für jeden anstrengend.
"Sie haben das Gefühl, dass sie zu Sündenböcken gemacht wurden, indem sie eine Schlagzeile machen, als ob sie die Klimakrise unverhältnismäßig weit über ihre Rolle hinaus verursachen", sagte Louise McHugh, Professorin für Psychologie am University College Dublin und Co-Leiterin der Studie über psychische Gesundheit irischer Landwirte. McHugh sagt, dass die Landwirte, mit denen sie im Rahmen ihrer Studie gesprochen hat, motiviert waren, sich an innovativen Praktiken und Strategien zu beteiligen, die sich mit dem Klimawandel befassen, aber der Meinung waren, dass diese ihre Stimmen einbeziehen und vor allem vor Ort umsetzbar sein müssen. Die Forscher sagen, dass Lösungen und mehr Unterstützung für die psychische Gesundheit der Landwirte gefunden werden müssen. In Irland haben sie bereits damit begonnen, Module zur psychischen Gesundheit für Studenten der Agrarwissenschaften anzubieten.
Laut Franziska Aumer, die in Bayern eine Ausbildung zur Milchviehhalterin macht, ist es auch wichtig, dass die Landwirte mehr Informationen und Dialogmöglichkeiten haben. Franziska erzählte, dass sich ein holländischer Freund von ihr im Alter von 25 Jahren das Leben nahm, nachdem er, wie viele andere in den Niederlanden, seinen Hof aufgrund strengerer Stickstoffemissionsnormen verloren hatte. "Er war voller Leben. Er hat jahrelang für seinen Hof gekämpft", sagte Aumer. Trotz der tragischen Geschichten, die sie erlebt hat, und der Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert ist, sagt Aumer, dass Aufgeben für sie keine Option ist. "Ich hoffe, dass Politik und Gesellschaft uns wertschätzen und uns unterstützen, damit unser Beruf eine Zukunft hat. Und damit es die Leute nicht kaputt macht."
Quelle: European Livestock Voice
Die landwirtschaftlichen Betriebe gehören diesen Familien seit Generationen, aber die europäische Politik tut oft wenig, um ihre Einkommen zu schützen, was zu finanzieller Unsicherheit führt und viele landwirtschaftliche Betriebe zur Schließung zwingt. Die Situation ist dramatischer, als man denkt. Eine Umfrage aus dem Jahr 2023 unter mehr als 250 irischen Landwirten ergab, dass 20 % in den letzten zwei Wochen über Selbstmord nachgedacht hatten, während fast 40 % von mäßigem bis extrem hohem Stress berichteten. In Nordbelgien gab fast die Hälfte der 600 befragten Landwirte an, dass ihre Arbeit eine Ursache für psychische Belastungen sei. Mehr als ein Viertel der deutschen und österreichischen Bauern gab an, an Burnout zu leiden, doppelt so viele wie in der Allgemeinbevölkerung.
Das Gefühl der Ohnmacht, Unterdrückung und Ungerechtigkeit kann unerträglich sein
Landwirte berichten, dass sie sich von der Klimapolitik, die sie zu Unrecht als die größten Umweltverschmutzer des Planeten bezeichnet, völlig erdrückt fühlen. Der Anstieg der Kosten, der Rückgang der Verkaufspreise und die allzu starren und unfairen Regeln für ihre Arbeit schädigen unweigerlich auch ihre psychische Gesundheit. Das Gefühl der Ohnmacht, Unterdrückung und Ungerechtigkeit soll für viele unerträglich geworden sein, angesichts der Schlagzeilen, die den Agrarsektor als Hauptursache für die globale Erwärmung und den Verlust der biologischen Vielfalt darstellen. Die Landwirtschaft weiß, wie viele andere Sektoren auch, dass sie die Auswirkungen auf die Umwelt verringern muss. In dieser Hinsicht hat die Nutztierhaltung Erfolge bei der Reduzierung von Emissionen gezeigt. Diese Verbesserungen sollten jedoch nicht dadurch untergraben werden, dass ihre Arbeit unmöglich gemacht wird. Schließlich sind es die Bauern, die die Lebensmittel in unsere Supermarktregale bringen.
Landwirte stehen an vorderster Front im Kampf gegen den Klimawandel
Die Landwirte stehen im Kampf gegen den Klimawandel an vorderster Front und gehören auch zu den am stärksten davon Betroffenen. Aber der untragbare Anstieg der Kosten, die immer strengeren Vorschriften für Emissionen und die Beschränkungen der Verwendung verschiedener Betriebsmittel, negative Darstellungen in den Medien und die Streichung von Subventionen für landwirtschaftliche Brennstoffe haben jeden Respekt vor ihrer grundlegenden Rolle als Hüter des Landes und Lieferanten von Lebensmitteln untergraben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Bauern aufgefordert, alles zu geben, um den Hunger zu beenden und unsere Lebensmittelversorgung zu sichern. Heute werden sie jedoch ständig kritisiert und als Umweltverschmutzer und Quäler von Tieren abgestempelt. Diese Art von ständiger Kritik wäre für jeden anstrengend.
"Sie haben das Gefühl, dass sie zu Sündenböcken gemacht wurden, indem sie eine Schlagzeile machen, als ob sie die Klimakrise unverhältnismäßig weit über ihre Rolle hinaus verursachen", sagte Louise McHugh, Professorin für Psychologie am University College Dublin und Co-Leiterin der Studie über psychische Gesundheit irischer Landwirte. McHugh sagt, dass die Landwirte, mit denen sie im Rahmen ihrer Studie gesprochen hat, motiviert waren, sich an innovativen Praktiken und Strategien zu beteiligen, die sich mit dem Klimawandel befassen, aber der Meinung waren, dass diese ihre Stimmen einbeziehen und vor allem vor Ort umsetzbar sein müssen. Die Forscher sagen, dass Lösungen und mehr Unterstützung für die psychische Gesundheit der Landwirte gefunden werden müssen. In Irland haben sie bereits damit begonnen, Module zur psychischen Gesundheit für Studenten der Agrarwissenschaften anzubieten.
Laut Franziska Aumer, die in Bayern eine Ausbildung zur Milchviehhalterin macht, ist es auch wichtig, dass die Landwirte mehr Informationen und Dialogmöglichkeiten haben. Franziska erzählte, dass sich ein holländischer Freund von ihr im Alter von 25 Jahren das Leben nahm, nachdem er, wie viele andere in den Niederlanden, seinen Hof aufgrund strengerer Stickstoffemissionsnormen verloren hatte. "Er war voller Leben. Er hat jahrelang für seinen Hof gekämpft", sagte Aumer. Trotz der tragischen Geschichten, die sie erlebt hat, und der Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert ist, sagt Aumer, dass Aufgeben für sie keine Option ist. "Ich hoffe, dass Politik und Gesellschaft uns wertschätzen und uns unterstützen, damit unser Beruf eine Zukunft hat. Und damit es die Leute nicht kaputt macht."
Quelle: European Livestock Voice
07.02.2024
Binnenfischereitagung des Instituts für Fischerei in Pöcking - unsere Einschätzung
Auch die diesjährige Fortbildungstagung für Fischhaltung und Fischzucht in Pöcking bei Starnberg am 16. und 17. Januar brachte ein bunt gemischtes Programm für die Fischzüchter und Fischzüchterinnen mit sich.
Die Veranstaltung begann nach dem Tätigkeitsbericht des Instituts für Fischerei (IfI) mit den Neuerungen im EMFAF und der letztjährigen Achterbahnfahrt im Fischottermanagement. Die „Standortbestimmung der Deutschen Aquakultur“ ließ aufhorchen, denn scheinbar wird die Fischzucht weltweit hochgeschätzt und gefördert, in der EU aber bürokratisch im Erhalt bzw. Wachstum blockiert. Die folgenden Vorträge beschäftigten sich mit der Fischgesundheit, einerseits mit dem fundierten Einsatz von Vakzinen, andererseits mit dem Einfluss des Mikrobioms auf die Fischgesundheit. Weitere Forschung in diesem Feld wird in Zukunft vielleicht neue Möglichkeiten der Gesunderhaltung von Fischen bringen. Eine weitere Basis für gesunde Fische ist die Keimreduktion im Zulaufwasser. In einer Untersuchung wurden Peressigsäure, Ozon und UV-C im Maßstab einer Forellenrinnenanlage verglichen. Passend dazu folgte die Vorstellung eines langjährigen Projekts zur Salmoniden-Satzfischerzeugung im Kaltwasser-Kreislaufsystem. Nicht nur für Kreislaufanlagenbetreiber waren Erkenntnisse zu gewinnen. Genauso verhielt es sich mit dem Vortrag über verschiedene Wasserüberwachungssysteme mit Fernübertragung, welche im Kontext Karpfenteich getestet wurden.
Der zweite Tag begann mit dem inspirierenden Vortrag über ein Betriebskonzept, welches verschiedenste Technologien (Holzvergaser, Solar) und Produktionsarten (Forellendurchflussanlage, Karpfenteiche, Kreislaufsystem Kalt- und Warmwasser, Insektenproduktion) vereint, um auch in Zukunft unter Druck von Prädatoren und Klimawandel die Fischzucht in die nächste Generation überführen zu können. Es gliederte sich ein detailreicher Vortrag über fundierte Zandersetzlingserzeugung für die Aufzucht in Kreislaufanlagen an. Abgerundet wurde der Themenblock durch einen Vortrag über die internationale Mikroalgenproduktion in Aquakultur. Die abschließenden Vorträge rundeten das Portfolio mit direkt umsetzbaren Erkenntnissen ab. Die oft diskutierte Konditionierung von Bachforellen für den Gewässerbesatz wurde unter Versuchsbedingungen getestet. Für die Satzkarpfenproduzenten wartete ein Vortrag über die Zufütterung von Raps zur Konditionsverbesserung. Abschließend wurden eindringliche Fakten zum Klimawandel vorgestellt sowie innovative Lösungswege, zu welchen man sich politisch und gesellschaftlich schnell bekennen sollte. Die Vortragsfolien werden demnächst wie immer auf der Homepage des IfI zur Verfügung gestellt.
Die Veranstaltung ist durchwegs als gelungen und informativ wertzuschätzen, was nicht zuletzt durch die vielfältigen Austauschmöglichkeiten unter Kollegen und Kolleginnen ermöglicht wird.
Die Veranstaltung begann nach dem Tätigkeitsbericht des Instituts für Fischerei (IfI) mit den Neuerungen im EMFAF und der letztjährigen Achterbahnfahrt im Fischottermanagement. Die „Standortbestimmung der Deutschen Aquakultur“ ließ aufhorchen, denn scheinbar wird die Fischzucht weltweit hochgeschätzt und gefördert, in der EU aber bürokratisch im Erhalt bzw. Wachstum blockiert. Die folgenden Vorträge beschäftigten sich mit der Fischgesundheit, einerseits mit dem fundierten Einsatz von Vakzinen, andererseits mit dem Einfluss des Mikrobioms auf die Fischgesundheit. Weitere Forschung in diesem Feld wird in Zukunft vielleicht neue Möglichkeiten der Gesunderhaltung von Fischen bringen. Eine weitere Basis für gesunde Fische ist die Keimreduktion im Zulaufwasser. In einer Untersuchung wurden Peressigsäure, Ozon und UV-C im Maßstab einer Forellenrinnenanlage verglichen. Passend dazu folgte die Vorstellung eines langjährigen Projekts zur Salmoniden-Satzfischerzeugung im Kaltwasser-Kreislaufsystem. Nicht nur für Kreislaufanlagenbetreiber waren Erkenntnisse zu gewinnen. Genauso verhielt es sich mit dem Vortrag über verschiedene Wasserüberwachungssysteme mit Fernübertragung, welche im Kontext Karpfenteich getestet wurden.
Der zweite Tag begann mit dem inspirierenden Vortrag über ein Betriebskonzept, welches verschiedenste Technologien (Holzvergaser, Solar) und Produktionsarten (Forellendurchflussanlage, Karpfenteiche, Kreislaufsystem Kalt- und Warmwasser, Insektenproduktion) vereint, um auch in Zukunft unter Druck von Prädatoren und Klimawandel die Fischzucht in die nächste Generation überführen zu können. Es gliederte sich ein detailreicher Vortrag über fundierte Zandersetzlingserzeugung für die Aufzucht in Kreislaufanlagen an. Abgerundet wurde der Themenblock durch einen Vortrag über die internationale Mikroalgenproduktion in Aquakultur. Die abschließenden Vorträge rundeten das Portfolio mit direkt umsetzbaren Erkenntnissen ab. Die oft diskutierte Konditionierung von Bachforellen für den Gewässerbesatz wurde unter Versuchsbedingungen getestet. Für die Satzkarpfenproduzenten wartete ein Vortrag über die Zufütterung von Raps zur Konditionsverbesserung. Abschließend wurden eindringliche Fakten zum Klimawandel vorgestellt sowie innovative Lösungswege, zu welchen man sich politisch und gesellschaftlich schnell bekennen sollte. Die Vortragsfolien werden demnächst wie immer auf der Homepage des IfI zur Verfügung gestellt.
Die Veranstaltung ist durchwegs als gelungen und informativ wertzuschätzen, was nicht zuletzt durch die vielfältigen Austauschmöglichkeiten unter Kollegen und Kolleginnen ermöglicht wird.
23.01.2024
Tirschenreuther Teichlandschaft gewinnt den Deutschen Kulturlandschaftspreis
„Wir haben wunderbare Bewerbungen aus ganz Deutschland erhalten, die deutlich machen, wie engagiert sich Landschaftspflege- und Bürgervereine, Naturschutz- und Landwirtschaftsverbände, aber auch einzelne Landwirte um den Erhalt der Kulturlandschaft kümmern“, zieht Susanne Schulze Bockeloh, geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Stiftung Kulturlandschaft, eine sehr positive Bilanz der erstmaligen Ausschreibung.
Aus insgesamt 61 Bewerbungen wurden 4 Gewinner ausgelotet, die sich im besonderen Maße für den Erhalt und ressourcenverträgliche Weiterentwicklung der über Jahrhunderte gewachsenen, bäuerlich geprägten Kulturlandschaft einsetzen. Dabei soll die Bewirtschaftung
ökonomisch rentabel, ökologisch intakt, sozial stabil und kulturell vielfältigist sein.
Für den Erhalt der artenreichen Kulturlandschaft "Karpfenteich" und die zeitgemäße Inwertsetzung der traditionellen Teichwirtschaft erhielt die ARGE Fisch am 22.01.2024 den Deutschen Kulurlandschaftspreis.
Weitere Infos: Hier
Bild (v.l.nr.r):
Gisela Reetz - Staatssekretärin im Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Dr. Mariya Ransberger - FLAG Managerin
Anna Klupp - Teichwirtin und Initiatorin der Bewerbung
Roland Grillmeier - Landrat des Landkreises Tirschenreuth
Susanne Schulze Bockeloh - Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Stiftung Kulturlandschaft
Dr. Ludger Schulze Pals - Geschäftsführer der Landwirtschaftsverlag GmbH,Münster
Aus insgesamt 61 Bewerbungen wurden 4 Gewinner ausgelotet, die sich im besonderen Maße für den Erhalt und ressourcenverträgliche Weiterentwicklung der über Jahrhunderte gewachsenen, bäuerlich geprägten Kulturlandschaft einsetzen. Dabei soll die Bewirtschaftung
ökonomisch rentabel, ökologisch intakt, sozial stabil und kulturell vielfältigist sein.
Für den Erhalt der artenreichen Kulturlandschaft "Karpfenteich" und die zeitgemäße Inwertsetzung der traditionellen Teichwirtschaft erhielt die ARGE Fisch am 22.01.2024 den Deutschen Kulurlandschaftspreis.
Weitere Infos: Hier
Bild (v.l.nr.r):
Gisela Reetz - Staatssekretärin im Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Dr. Mariya Ransberger - FLAG Managerin
Anna Klupp - Teichwirtin und Initiatorin der Bewerbung
Roland Grillmeier - Landrat des Landkreises Tirschenreuth
Susanne Schulze Bockeloh - Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Stiftung Kulturlandschaft
Dr. Ludger Schulze Pals - Geschäftsführer der Landwirtschaftsverlag GmbH,Münster
14.12.2023
Kampagne #IWorkInAquaculture soll SchülerInnen auf die Chancen im Aquakultursektor aufmerksam machen
DieSchulkampagne #IWorkInAquaculture zielt darauf ab, das Bewusstsein für nachhaltige
Aquakulturpraktiken in Europa, die Vorteile des Fischkonsums für die menschliche Gesundheit und das Interesse an einer Tätigkeit in der Aquakultur zu steigern.
NewTechAqua hat verschiedene Unterrichtsmaterialien entwickelt, wie z. B. eine PowerPoint-Präsentation, Informationsblätter, Videos und Spiele, die sich an Schüler der Sekundarstufe und der Oberstufe richten, um die wichtige Rolle des Aquakultursektors in der Europäischen Union, die Chancen und Herausforderungen für seine Entwicklung und die Beschäftigungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Forschung und Innovation zu erläutern. Alle Materialien sind in englischer Sprache verfasst.
Die Zielgruppe sind Sekundarschulen und Gymnasien (im Alter von 14 bis 18 Jahren).
Diese Schulkampagne richtet sich an LehrerInnen, die Expertenwissen über Aquakultur suchen und ihren SchülerInnen die Möglichkeit geben wollen, wissenschaftliche Aktivitäten zu erleben. Der Zugang und die Nutzung dieses Kits ist kostenlos, offen und zugänglich für alle Interessengruppen und Personen, die sich für das Thema interessieren.
Die Präsentation und die Infos zum AquaponicKit sind als Download beigefügt.
Die Videos sind auf Youtube zu finden: hier
Aquakulturpraktiken in Europa, die Vorteile des Fischkonsums für die menschliche Gesundheit und das Interesse an einer Tätigkeit in der Aquakultur zu steigern.
NewTechAqua hat verschiedene Unterrichtsmaterialien entwickelt, wie z. B. eine PowerPoint-Präsentation, Informationsblätter, Videos und Spiele, die sich an Schüler der Sekundarstufe und der Oberstufe richten, um die wichtige Rolle des Aquakultursektors in der Europäischen Union, die Chancen und Herausforderungen für seine Entwicklung und die Beschäftigungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Forschung und Innovation zu erläutern. Alle Materialien sind in englischer Sprache verfasst.
Die Zielgruppe sind Sekundarschulen und Gymnasien (im Alter von 14 bis 18 Jahren).
Diese Schulkampagne richtet sich an LehrerInnen, die Expertenwissen über Aquakultur suchen und ihren SchülerInnen die Möglichkeit geben wollen, wissenschaftliche Aktivitäten zu erleben. Der Zugang und die Nutzung dieses Kits ist kostenlos, offen und zugänglich für alle Interessengruppen und Personen, die sich für das Thema interessieren.
Die Präsentation und die Infos zum AquaponicKit sind als Download beigefügt.
Die Videos sind auf Youtube zu finden: hier
13.12.2023
Statement des VDBA zur Pressemitteilung von Frau Staatssekretärin Bender zum Ergebnis der Fischereiratssitzung in der Sache "Licht und Schatten beim A
Pressemitteilung des BMEL: hier
Statement des VDBA zur Pressemitteilung von Frau Staatssekretärin Bender zum Ergebnis der Fischereiratssitzung in der Sache "Licht und Schatten beim Aal"
Die Deutsche Seen- und Flussfischerei freut sich ausdrücklich darüber, dass Fischer und Angler weiter die bislang erfolgreiche Wiederauffüllung des Europäischen Aalbestandes fortsetzen kann. Kein anderer verbaler Aalschützer hat dafür so viel privates Geld und Zeit investiert, wie die deutschen Fischer und Angler. Immerhin realisiert Deutschland in Umsetzung der von der Kommission am 08.04.2010 genehmigten Aalmanagementpläne die umfassendsten Aalbesatzprojekte zur Wiederauffüllung des Aallaicherbestandes in der EU. Der inzwischen herangewachsene adulte Aallaicherbestand in den deutschen Aaleinzugsgebieten spricht für den Erfolg der Besatzmaßnahmen. Dabei hervorzuheben ist insbesondere der hohe Bestand laichreifer weiblicher Aale von über 1 kg Stückmasse, was hohe Eizahlen und Reproduktionsraten zur Folge hat. Bestätigt wird diese Erwartung durch die beobachte Zunahme des Glasaalaufkommens insbesondere in Frankreich. Die Fangquoten werden immer schneller abgefischt, d.h. immer mehr Glasaale verbleiben in den Ästuarien ein sog. win-win Effekt. Die Ausweitung der Glasaalfischerei sichert die für die Wiederauffüllungsprogramme benötigten Glasaale und stabile Preise ohne dabei den Bestand zu gefährden, denn diese Maßnahme senkt gleichzeitig die naturgegebene dichteabhängige Mortalität in den Ästuarien erheblich. So erreichen auch mehr Aale die Laichreife. Insofern ist die vom BMEL hierfür postulierte Gefahr nicht gegeben ja sogar unbegründet. Vorsichtiges Vorgehen heißt eben auch ganzheitliche Lösungsansätze herbeizuführen. Der VDBA begrüßt ausdrücklich die Bemühungen des BMEL für eine einheitliche Schonzeit in der Ostsee. Dabei sollten sich die Ostseeanrainer unbedingt auch auf eine einheitliche Grenze des Geltungsbereichs des Schongebietes einigen. In Übereinstimmung mit Art. 8 (2) der EU-Aal-VO kommt hierfür wohl nur eine Grenze seewärts der von den Anrainern festgelegten Grenze der Aaleinzugsgebiete in Frage. In den Aaleinzugsgebieten sollten ausschließlich die Maßnahmen der genehmigten Aalmanagementpläne greifen und weiter umgesetzt und aktualisiert werden. Eine derartige Regelung hat der VDBA bereits im Ergebnis der Fischereiratssitzung erwartet, allerdings wohl vergeblich. Wir bedanken uns bei den EU-Fischereiministerinnen und -minister, die dem betreffenden Fischereisektor tatsächlich Stabilität bei der weiteren Umsetzung von Aalschutz- und -wiederauffüllungsmaßnahmen gegeben haben und das hoffentlich so langfristig, wie es EU-Aal-VO und Aalmanagementpläne es vorsehen. Wiederholt und unendlich zu rügen ist die schon beschämende Außerachtlassung aller anderen anthropogenen und nicht anthropogenen Mortalitäten.
Brandenburg, 13.12.2023
Ronald Menzel
Vizepräsident
Statement des VDBA zur Pressemitteilung von Frau Staatssekretärin Bender zum Ergebnis der Fischereiratssitzung in der Sache "Licht und Schatten beim Aal"
Die Deutsche Seen- und Flussfischerei freut sich ausdrücklich darüber, dass Fischer und Angler weiter die bislang erfolgreiche Wiederauffüllung des Europäischen Aalbestandes fortsetzen kann. Kein anderer verbaler Aalschützer hat dafür so viel privates Geld und Zeit investiert, wie die deutschen Fischer und Angler. Immerhin realisiert Deutschland in Umsetzung der von der Kommission am 08.04.2010 genehmigten Aalmanagementpläne die umfassendsten Aalbesatzprojekte zur Wiederauffüllung des Aallaicherbestandes in der EU. Der inzwischen herangewachsene adulte Aallaicherbestand in den deutschen Aaleinzugsgebieten spricht für den Erfolg der Besatzmaßnahmen. Dabei hervorzuheben ist insbesondere der hohe Bestand laichreifer weiblicher Aale von über 1 kg Stückmasse, was hohe Eizahlen und Reproduktionsraten zur Folge hat. Bestätigt wird diese Erwartung durch die beobachte Zunahme des Glasaalaufkommens insbesondere in Frankreich. Die Fangquoten werden immer schneller abgefischt, d.h. immer mehr Glasaale verbleiben in den Ästuarien ein sog. win-win Effekt. Die Ausweitung der Glasaalfischerei sichert die für die Wiederauffüllungsprogramme benötigten Glasaale und stabile Preise ohne dabei den Bestand zu gefährden, denn diese Maßnahme senkt gleichzeitig die naturgegebene dichteabhängige Mortalität in den Ästuarien erheblich. So erreichen auch mehr Aale die Laichreife. Insofern ist die vom BMEL hierfür postulierte Gefahr nicht gegeben ja sogar unbegründet. Vorsichtiges Vorgehen heißt eben auch ganzheitliche Lösungsansätze herbeizuführen. Der VDBA begrüßt ausdrücklich die Bemühungen des BMEL für eine einheitliche Schonzeit in der Ostsee. Dabei sollten sich die Ostseeanrainer unbedingt auch auf eine einheitliche Grenze des Geltungsbereichs des Schongebietes einigen. In Übereinstimmung mit Art. 8 (2) der EU-Aal-VO kommt hierfür wohl nur eine Grenze seewärts der von den Anrainern festgelegten Grenze der Aaleinzugsgebiete in Frage. In den Aaleinzugsgebieten sollten ausschließlich die Maßnahmen der genehmigten Aalmanagementpläne greifen und weiter umgesetzt und aktualisiert werden. Eine derartige Regelung hat der VDBA bereits im Ergebnis der Fischereiratssitzung erwartet, allerdings wohl vergeblich. Wir bedanken uns bei den EU-Fischereiministerinnen und -minister, die dem betreffenden Fischereisektor tatsächlich Stabilität bei der weiteren Umsetzung von Aalschutz- und -wiederauffüllungsmaßnahmen gegeben haben und das hoffentlich so langfristig, wie es EU-Aal-VO und Aalmanagementpläne es vorsehen. Wiederholt und unendlich zu rügen ist die schon beschämende Außerachtlassung aller anderen anthropogenen und nicht anthropogenen Mortalitäten.
Brandenburg, 13.12.2023
Ronald Menzel
Vizepräsident
13.12.2023
EU-Fischereirat legt Fangmöglichkeiten für Nordsee und Nordostatlantik fest – Fortsetzung der Maßnahmen zum Schutz des Europäischen Aalbestands beschl
Bender: „Licht und Schatten beim Aal“
Statement des VDBA: hier
Die EU-Fischereiministerinnen und -minister haben sich nach langen Verhandlungen am Dienstag in Brüssel auf die zulässigen Gesamtfangmengen für 2024 in der Nordsee und im Nordostatlantik sowie weiteren Gewässern geeinigt. Zentral in den Verhandlungen waren – wie bereits im Vorjahr – Maßnahmen zum Schutz des Europäischen Aals, der sich weiterhin in einem äußerst kritischen Zustand befindet. Die für das laufende Jahr geltenden Maßnahmen sollen daher auch 2024 weitgehend fortgesetzt werden. Hierzu gehört insbesondere eine sechsmonatige Schonzeit und das Verbot der Freizeitfischerei auf Aal im maritimen Bereich. Deutschland hat sich in den Verhandlungen erfolgreich dafür eingesetzt, dass für die Ostsee eine einheitliche Schließzeit gilt. Diese wird im Nachgang des Rates von den Anrainerstaaten der Ostsee gemeinsam festgelegt. Sollte es dabei nicht zu einer Einigung zwischen den Anrainern kommen, ist die Schließzeit auf den Zeitraum vom 15. September 2024 bis 14. März 2025 festgelegt.
Dazu erklärt die Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Silvia Bender: „Mit den Verhandlungsergebnissen kommen wir unserer Verantwortung zur nachhaltigen Bewirtschaftung und zum Wiederaufbau der Fischbestände nach und geben dem Fischereisektor Stabilität für das kommende Jahr. Die Maßnahmen der Vorjahre zeigen Wirkung. Daher können wir bei vielen Beständen in der Nordsee die Quoten im Einklang mit den wissenschaftlichen Empfehlungen anheben.
Beim Aalbestand haben wir uns bis zuletzt für ein vorsichtigeres Vorgehen eingesetzt. Ein Fortschritt gegenüber dem Vorjahr ist die einheitliche Schließzeit in der Ostsee. Es bringt nichts, wenn sich Aale ungehindert aus deutschen Gewässern auf den Weg machen, aber dann in den Meerengen zwischen Ostsee und Nordsee gefangen werden. Das wird jetzt durch die Neuregelung verhindert. Die Ausweitung der Glasaalfischerei hingegen sehen wir kritisch, da sie die Gefahr für den Bestand erhöht. Wir fordern die Kommission daher auf, vor den Verhandlungen im kommenden Jahr eine Folgenabschätzung vorzulegen.“
Da die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich und Norwegen rechtzeitig vor der Ratssitzung abgeschlossen werden konnten, besteht für die Fischerei vom Beginn des Jahres 2024 an vollständige Planungssicherheit – erstmalig seit dem Brexit. Die Fangmengen der für Deutschland besonders wichtigen Bestände Hering, Kabeljau, Seelachs, Schellfisch und Scholle steigen in der Nordsee an. Beim Kabeljau hatte sich das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) für eine Festsetzung der Fangmengen nach dem Vorsorgeansatz mit Blick auf eine weitere Erholung des Bestands ausgesprochen. Der in den trilateralen Verhandlungen erzielte Kompromiss weicht allerdings davon nach oben ab. Die weiterhin geltende strenge Fangbegrenzung für Hering im Skagerrak und Kattegat ermöglicht eine fortgesetzte Erholung des Herings in der westlichen Ostsee auch im kommenden Jahr. Bei Makrele, die von allen Küstenstaaten des Nordostatlantiks gemeinsam bewirtschaftet wird, sinkt die Fangmenge leicht.
Neben den Quoten für die Nordsee und den Nordostatlantik wurden auch Fangmöglichkeiten für das Mittelmeer und das Schwarze Meer vereinbart.
EU- und deutsche Quoten für das Jahr 2024 bei wichtigen Beständen – in der vierten Spalte der prozentuale Wert im Vergleich zu den Quoten für das Jahr 2023
Die EU-Fischereiministerinnen und -minister haben sich nach langen Verhandlungen am Dienstag in Brüssel auf die zulässigen Gesamtfangmengen für 2024 in der Nordsee und im Nordostatlantik sowie weiteren Gewässern geeinigt. Zentral in den Verhandlungen waren – wie bereits im Vorjahr – Maßnahmen zum Schutz des Europäischen Aals, der sich weiterhin in einem äußerst kritischen Zustand befindet. Die für das laufende Jahr geltenden Maßnahmen sollen daher auch 2024 weitgehend fortgesetzt werden. Hierzu gehört insbesondere eine sechsmonatige Schonzeit und das Verbot der Freizeitfischerei auf Aal im maritimen Bereich. Deutschland hat sich in den Verhandlungen erfolgreich dafür eingesetzt, dass für die Ostsee eine einheitliche Schließzeit gilt. Diese wird im Nachgang des Rates von den Anrainerstaaten der Ostsee gemeinsam festgelegt. Sollte es dabei nicht zu einer Einigung zwischen den Anrainern kommen, ist die Schließzeit auf den Zeitraum vom 15. September 2024 bis 14. März 2025 festgelegt.
Dazu erklärt die Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Silvia Bender: „Mit den Verhandlungsergebnissen kommen wir unserer Verantwortung zur nachhaltigen Bewirtschaftung und zum Wiederaufbau der Fischbestände nach und geben dem Fischereisektor Stabilität für das kommende Jahr. Die Maßnahmen der Vorjahre zeigen Wirkung. Daher können wir bei vielen Beständen in der Nordsee die Quoten im Einklang mit den wissenschaftlichen Empfehlungen anheben.
Beim Aalbestand haben wir uns bis zuletzt für ein vorsichtigeres Vorgehen eingesetzt. Ein Fortschritt gegenüber dem Vorjahr ist die einheitliche Schließzeit in der Ostsee. Es bringt nichts, wenn sich Aale ungehindert aus deutschen Gewässern auf den Weg machen, aber dann in den Meerengen zwischen Ostsee und Nordsee gefangen werden. Das wird jetzt durch die Neuregelung verhindert. Die Ausweitung der Glasaalfischerei hingegen sehen wir kritisch, da sie die Gefahr für den Bestand erhöht. Wir fordern die Kommission daher auf, vor den Verhandlungen im kommenden Jahr eine Folgenabschätzung vorzulegen.“
Da die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich und Norwegen rechtzeitig vor der Ratssitzung abgeschlossen werden konnten, besteht für die Fischerei vom Beginn des Jahres 2024 an vollständige Planungssicherheit – erstmalig seit dem Brexit. Die Fangmengen der für Deutschland besonders wichtigen Bestände Hering, Kabeljau, Seelachs, Schellfisch und Scholle steigen in der Nordsee an. Beim Kabeljau hatte sich das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) für eine Festsetzung der Fangmengen nach dem Vorsorgeansatz mit Blick auf eine weitere Erholung des Bestands ausgesprochen. Der in den trilateralen Verhandlungen erzielte Kompromiss weicht allerdings davon nach oben ab. Die weiterhin geltende strenge Fangbegrenzung für Hering im Skagerrak und Kattegat ermöglicht eine fortgesetzte Erholung des Herings in der westlichen Ostsee auch im kommenden Jahr. Bei Makrele, die von allen Küstenstaaten des Nordostatlantiks gemeinsam bewirtschaftet wird, sinkt die Fangmenge leicht.
Neben den Quoten für die Nordsee und den Nordostatlantik wurden auch Fangmöglichkeiten für das Mittelmeer und das Schwarze Meer vereinbart.
EU- und deutsche Quoten für das Jahr 2024 bei wichtigen Beständen – in der vierten Spalte der prozentuale Wert im Vergleich zu den Quoten für das Jahr 2023
| Bestand | EU-Quote (in Tonnen) |
Deutsche Quote (in Tonnen) |
Veränderung DEU-Quote 2024/2023 (%) |
| Hering (Nordsee) | 209.457 | 48.595 | + 30 % |
| Seelachs (Nordsee) | 22.870 | 5.991 | + 18 % |
| Kabeljau (Nordsee) | 9.054 | 2.212 | + 12 % |
| Schellfisch (Nordsee) | 12.768 | 2.630 | + 66 % |
| Scholle (Nordsee) | 67.525 | 5.446 | +23 % |
| Makrele (Nordostatlantik – westliche Gewässer) | 93.464 | 14.268 | - 9 % |
06.12.2023
Verordnung zur Entnahme von Fischottern in Bayern außer Kraft gesetzt
Mit Entscheidung vom 30.November.2023 hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Verordnung zur Entnahme von Fischottern außer Kraft gesetzt. Gegen die Ausnahme-Verordnungen hatten sich drei Umweltverbände mit einem Normenkontrollantrag und einem Eilantrag gewandt. Der BayVGH hat den Eilanträgen nun stattgegeben und beide Verordnungen bis zur Entscheidung in der Hauptsache vorläufig außer Vollzug gesetzt. Fischotter dürfen damit vorerst auch nicht ausnahmsweise getötet werden.
Pressemitteilung des BayVGH: hier
Pressemitteilung des BayVGH: hier
29.11.2023
Fischerei-Exkursion des Landesfischereiverbands Sachsen-Anhalt in die Oberpfalz
Vom 07. bis 08. Oktober unternahm der Landesfischereiverband Sachsen-Anhalt, gefördert durch Mittel der Fischereiabgabe des Landes Sachsen-Anhalt, seine diesjährige Lehrfahrt. Ziel der Busreise war die Oberpfalz mit seinen 14.000 Teichen und über 10.000 Kilometern Fließgewässern. Derzeit erzeugen noch etwa 2000 Teichwirte, zumeist im Nebenerwerb, ein Viertel der bundesdeutschen Spiegelkarpfenmenge in der Region.
Erstes Ziel war ein Besuch des Teichwirtschaftlichen Beispielbetriebs Wöllershof (Foto), der seit über 50 Jahren Sitz der Fachberatung für Fischerei in Niederbayern ist. Am Standort wird die Fischbrut für die heimischen Teichwirtschaften erzeugt, außerdem finden dort zahlreiche Arterhaltungsprogramme statt. Fischarten, wie Karausche, Schmerle, Schlammpeitzger, Nerfling, Nase und Barbe werden reproduziert, um die genetische Vielfalt in den Gewässern Süddeutschlands zu erhalten. Fischwirtschaftsmeister und Standortleiter Kevin Bäumler erläuterte während einer Führung durch die Teichanlage und des Bruthauses, worauf es unter anderem bei der Zucht und der Fütterung der am stärksten vom Aussterben bedrohte Tiergruppe der Welt, den Stören, ankommt. Dr. vet. Bernhard Feneis, Präsident des Verbands der Deutschen Binnenfischerei und Aquakultur und Tierarzt in der Region, nahm sich ebenfalls Zeit für die Reisegruppe und erklärte unter anderem, wie Karpfenläuse und Kiemenwürmer durch Besatz und Management kontrolliert werden können und wie Salzbäder für verschiedene Störaltersklassen dosiert werden sollten. Zudem konnten sich die Mitglieder untereinander austauschen und mehr über die derzeitige Fischereipolitik auf Bundes- und Europaebene erfahren.
Nach dem Mittagessen startet eine interessante Betriebsbesichtigung im Fischereibetrieb Stier. Neben den Möglichkeiten zur Nutzung von Holzvergasern zur Energiegewinnung, wurde über die halbautomatische Produktion von Schwarzen Soldatenfliegenlarven zur Fischernährung und über die Zander- und Garnelenhaltung referiert. Die Funktionsweise des installierten Holzvergasers, der durch ein 1200°C heißes Pyrolyseverfahren das angeschlossene Blockheizkraftwerk antreibt, wurde an der Anlage erläutert. Durch die Verwendung von acht Schüttmetern Hackschnitzel pro Tag kann eine thermische Abwärme von 140KW erzeugt werden. Diese Energie reicht aus, um eine 30°C Kreislaufanlage für Garnelen, eine 24°C Kreislaufanlage für Zander, eine 34°C warme Klimakammer für Soldatenfliegen sowie eine Warmwasseraufbereitung am Standort zu betreiben. Die Soldatenfliegenlarven werden mit einer Mischung aus Weizenkleien und Fischabfällen ernährt und weisen innerhalb von 7 Tagen eine beeindruckende 250-fache Gewichtszunahme auf. Im Hotel „Zur Alten Post“ in Bärnau ließ die Reisegruppe den Abend bei einem zünftigen Essen und Kamingesprächen, gemütlich ausklingen.
Nach dem Sonntagsfrühstück besuchte die Reisegruppe das Fischereimuseum in Tirschenreuth. Die Führung, geleitet von einer Teichwirtin und einem Fischwirt aus der Region, bot eine umfassende Darstellung der Historie der Karpfenproduktion in der Oberpfalz. Es wurde erklärt, dass der ton-, lehm- und kaolinhaltige Boden sich ideal für die Anlage von Weihern und Teichen eignete. Diese künstlich geschaffenen Gewässer dienten der Sicherung von Siedlungen, dem Betrieb von Wasserkraftanlagen und nicht zuletzt der Fischproduktion. Die Anlage von Teichen begann in der Region im 11. Jahrhundert, und die Blütezeit der Teichwirtschaft erstreckte sich von der Mitte des 14. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Dies war eine Reaktion auf die Agrarkrise des späten Mittelalters, die nach dem Ausbruch der großen Pest von 1347 bis 1351 zu stark gesunkenen Getreidepreisen führte. Der Verkauf von Getreideüberschüssen war wenig profitabel, weshalb Bauern und feudale Grundherren nach neuen Einkommensquellen suchten. Spezialkulturen wie Wein- und Hopfenanbau sowie die Fischzucht boten lukrative Alternativen, die in der Region stark ausgebaut wurden.
Der Besuch wurde durch eine Tour durch das Zisterzienserklosters Waldsassen abgerundet. Die Zisterzienser legten ebenfalls besonderen Wert auf Wasserbau und Gewässernutzung. Jedoch wurde auch der klösterliche Teichbau vor allem betrieben, als der Fisch im Vergleich zum Getreide teuer war. Mit dem Anstieg der Getreidepreise endete die Ära des Teichbaus in der Region. Durch die Teichbewirtschaftung über die Jahrhunderte hinweg konnte „Das Land der tausend Teiche“ bis in unsere Zeit erhalten werden. Das Teichgebiet gilt heute als einzigartige Kulturlandschaft und einer der artenreichsten Lebensräume Deutschlands.
Die Lehrfahrt wurde durch die gemeinsamen Erlebnisse, die interessanten Gespräche und die geteilten Momente zu einer unvergesslichen Erfahrung. Der Landesfischereiverband Sachsen-Anhalt drückt seinen Dank an alle Beteilligten aus und lädt herzlich alle Fischereiinteressierten zur nächsten Lehrfahrt nach Dänemark vom 04. bis 06.10.2024 ein.
Erstes Ziel war ein Besuch des Teichwirtschaftlichen Beispielbetriebs Wöllershof (Foto), der seit über 50 Jahren Sitz der Fachberatung für Fischerei in Niederbayern ist. Am Standort wird die Fischbrut für die heimischen Teichwirtschaften erzeugt, außerdem finden dort zahlreiche Arterhaltungsprogramme statt. Fischarten, wie Karausche, Schmerle, Schlammpeitzger, Nerfling, Nase und Barbe werden reproduziert, um die genetische Vielfalt in den Gewässern Süddeutschlands zu erhalten. Fischwirtschaftsmeister und Standortleiter Kevin Bäumler erläuterte während einer Führung durch die Teichanlage und des Bruthauses, worauf es unter anderem bei der Zucht und der Fütterung der am stärksten vom Aussterben bedrohte Tiergruppe der Welt, den Stören, ankommt. Dr. vet. Bernhard Feneis, Präsident des Verbands der Deutschen Binnenfischerei und Aquakultur und Tierarzt in der Region, nahm sich ebenfalls Zeit für die Reisegruppe und erklärte unter anderem, wie Karpfenläuse und Kiemenwürmer durch Besatz und Management kontrolliert werden können und wie Salzbäder für verschiedene Störaltersklassen dosiert werden sollten. Zudem konnten sich die Mitglieder untereinander austauschen und mehr über die derzeitige Fischereipolitik auf Bundes- und Europaebene erfahren.
Nach dem Mittagessen startet eine interessante Betriebsbesichtigung im Fischereibetrieb Stier. Neben den Möglichkeiten zur Nutzung von Holzvergasern zur Energiegewinnung, wurde über die halbautomatische Produktion von Schwarzen Soldatenfliegenlarven zur Fischernährung und über die Zander- und Garnelenhaltung referiert. Die Funktionsweise des installierten Holzvergasers, der durch ein 1200°C heißes Pyrolyseverfahren das angeschlossene Blockheizkraftwerk antreibt, wurde an der Anlage erläutert. Durch die Verwendung von acht Schüttmetern Hackschnitzel pro Tag kann eine thermische Abwärme von 140KW erzeugt werden. Diese Energie reicht aus, um eine 30°C Kreislaufanlage für Garnelen, eine 24°C Kreislaufanlage für Zander, eine 34°C warme Klimakammer für Soldatenfliegen sowie eine Warmwasseraufbereitung am Standort zu betreiben. Die Soldatenfliegenlarven werden mit einer Mischung aus Weizenkleien und Fischabfällen ernährt und weisen innerhalb von 7 Tagen eine beeindruckende 250-fache Gewichtszunahme auf. Im Hotel „Zur Alten Post“ in Bärnau ließ die Reisegruppe den Abend bei einem zünftigen Essen und Kamingesprächen, gemütlich ausklingen.
Nach dem Sonntagsfrühstück besuchte die Reisegruppe das Fischereimuseum in Tirschenreuth. Die Führung, geleitet von einer Teichwirtin und einem Fischwirt aus der Region, bot eine umfassende Darstellung der Historie der Karpfenproduktion in der Oberpfalz. Es wurde erklärt, dass der ton-, lehm- und kaolinhaltige Boden sich ideal für die Anlage von Weihern und Teichen eignete. Diese künstlich geschaffenen Gewässer dienten der Sicherung von Siedlungen, dem Betrieb von Wasserkraftanlagen und nicht zuletzt der Fischproduktion. Die Anlage von Teichen begann in der Region im 11. Jahrhundert, und die Blütezeit der Teichwirtschaft erstreckte sich von der Mitte des 14. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Dies war eine Reaktion auf die Agrarkrise des späten Mittelalters, die nach dem Ausbruch der großen Pest von 1347 bis 1351 zu stark gesunkenen Getreidepreisen führte. Der Verkauf von Getreideüberschüssen war wenig profitabel, weshalb Bauern und feudale Grundherren nach neuen Einkommensquellen suchten. Spezialkulturen wie Wein- und Hopfenanbau sowie die Fischzucht boten lukrative Alternativen, die in der Region stark ausgebaut wurden.
Der Besuch wurde durch eine Tour durch das Zisterzienserklosters Waldsassen abgerundet. Die Zisterzienser legten ebenfalls besonderen Wert auf Wasserbau und Gewässernutzung. Jedoch wurde auch der klösterliche Teichbau vor allem betrieben, als der Fisch im Vergleich zum Getreide teuer war. Mit dem Anstieg der Getreidepreise endete die Ära des Teichbaus in der Region. Durch die Teichbewirtschaftung über die Jahrhunderte hinweg konnte „Das Land der tausend Teiche“ bis in unsere Zeit erhalten werden. Das Teichgebiet gilt heute als einzigartige Kulturlandschaft und einer der artenreichsten Lebensräume Deutschlands.
Die Lehrfahrt wurde durch die gemeinsamen Erlebnisse, die interessanten Gespräche und die geteilten Momente zu einer unvergesslichen Erfahrung. Der Landesfischereiverband Sachsen-Anhalt drückt seinen Dank an alle Beteilligten aus und lädt herzlich alle Fischereiinteressierten zur nächsten Lehrfahrt nach Dänemark vom 04. bis 06.10.2024 ein.
22.11.2023
FEAP-Stellungnahme zum Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs über die EU-Aquakulturpolitik
Die Federation of European Aquaculture Producers äußert sich zu dem Bericht des EuRH und der Antwort der Kommission
"Die europäische Aquakultur ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen Lebensmittelsicherheit, aber ihr stagnierender Zustand muss innerhalb dieses Jahrzehnts behoben werden."
Der Europäische Rechnungshof (ERH) veröffentlichte letzte Woche einen Sonderbericht über die EU-Aquakulturpolitik mit dem Titel "Stagnierende Produktion und unklare Ergebnisse trotz erhöhter EU-Finanzierung "1. Gleichzeitig veröffentlichte die Europäische Kommission eine Antwort2 auf dieses Dokument.
In seinem Bericht untersuchte der ERH, ob die Europäische Kommission (EK) und die Mitgliedstaaten (MS) die nachhaltige Entwicklung der EU-Aquakultur wirksam gefördert haben. Er kam zu dem Schluss, dass sich der strategische Rahmen der EU für die Aquakultur in den letzten Jahren zwar verbessert hat, die Aquakultur in der EU jedoch kaum gewachsen ist und es keine zuverlässigen Indikatoren gibt, um die Nachhaltigkeit des Sektors und den Beitrag der erhöhten EU-Finanzierung zur Entwicklung der EU-Aquakultur zu verfolgen.
Der ERH empfiehlt, die Mitgliedstaaten bei der Beseitigung der Hindernisse für die nachhaltige Entwicklung der EU-Aquakultur zu unterstützen, die EU-Mittel gezielter einzusetzen und die Überwachung der Leistung der EU-Mittel und der ökologischen Nachhaltigkeit zu verbessern.
In ihrer Antwort an den Rechnungshof, die zur gleichen Zeit veröffentlicht wurde, geht die Kommission auf ihre Arbeit im Bereich der Aquakultur ein, einschließlich der strategischen Leitlinien für 2021, der offenen Koordinierungsmethode, des Unterstützungsmechanismus für die Aquakultur und der teilweisen Überwachung des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) und des Europäischen Fonds für die maritime Wirtschaft, Fischerei und Aquakultur (EMFAF). Die Europäische Kommission räumt jedoch ein, dass sie im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung nicht in der Lage ist, die Wirksamkeit der Verwendung von EU-Mitteln oder, noch weiter gefasst, die ökologische Nachhaltigkeit der EU-Aquakultur insgesamt zu überwachen. Die Kommission ist der Ansicht, dass es eine solide Grundlage gibt, die es dem EU-Aquakultursektor ermöglicht, zu wachsen und sein volles Potenzial im Hinblick auf den Beitrag zu den Zielen des Europäischen Grünen Deals zu erreichen. Die Kommission ist jedoch der Ansicht, dass es noch zu früh ist, um die Ergebnisse der neuen Strategie zu bewerten.
Was die Finanzierung der Aquakultur betrifft, so stimmt die Kommission zu, dass eine solide Überwachung notwendig ist. Gleichzeitig ist sie der Ansicht, dass das Kontrollsystem des EMFAF auf der Grundlage der Erfahrungen mit dem EMFF verbessert und vereinfacht wurde.
Der FEAP ist davon überzeugt, dass die Aquakultur in der EU ein großes Potenzial für die Bereitstellung von Nahrungsmitteln aus dem Wasser, für die wirtschaftliche Entwicklung und für die Schaffung von Arbeitsplätzen hat, wie dies auch in anderen Teilen der Welt der Fall ist. Außerdem kann die derzeitige Stagnation der Aquakultur in der EU überwunden werden, wenn die richtigen Maßnahmen ergriffen werden.
Abgesehen von einigen Lücken, die der FEAP in dem Sonderbericht* des Rechnungshofs festgestellt hat, ist der FEAP der Ansicht, dass der Rechnungshof im Allgemeinen einen gründlichen Bericht vorgelegt hat, der die Situation, die Herausforderungen und die administrativen Unzulänglichkeiten der Aquakulturentwicklung in der EU beschreibt. Zu unserer größten Besorgnis hält FEAP die Antwort der Europäischen Kommission jedoch für kurzsichtig.
Die Kommission erkennt die wirklichen Gründe, die das Potenzial der Aquakultur in der EU hemmen, nicht an und bietet auch keine Lösungen an.
Der ERH hat auf eine ineffektive Raumplanung für die Aquakultur und komplizierte Genehmigungsverfahren als Gründe hingewiesen, genau wie die EK in ihren strategischen Leitlinien für 2021. In Wirklichkeit sind dies jedoch nur Symptome eines Problems und nicht die eigentlichen Ursachen für die Situation.
Die FEAP nimmt in dieser Pressemitteilung Stellung zum Sonderbericht des ECA und zur Aquakulturpolitik der EU im Allgemeinen.
FEAP stimmt mit ECA darin überein, dass sich der strategische Rahmen der EU für die Aquakultur in den letzten Jahren verbessert hat. Da es jedoch noch zu früh ist, um die Ergebnisse einer solchen neuen Strategie zu bewerten, betont dieser Verband, dass die Strategie 2021 der Europäischen Kommission nicht ausreichen wird, um das gleiche Wachstum des Sektors wie in anderen Ländern wie Norwegen, Großbritannien, der Türkei oder in vielen anderen Teilen der Welt zu erreichen.
Der ERH hat zu Recht festgestellt, dass im Zeitraum 2014-2020 in der EU nur sehr wenige neue Aquakulturbetriebe gegründet wurden, obwohl öffentliche Mittel zur Verfügung stehen. Der FEAP kann verstehen, dass der ERH möglicherweise nicht genügend Überblick hat, um diese Situation vollständig zu erklären, aber die Kommission sollte darüber Bescheid wissen. Die EU-Kommission ist sich bewusst, dass das Wachstum der Aquakultur durch übermäßigen Verwaltungsaufwand aufgrund einer übereifrigen Umsetzung von Umweltvorschriften, ungleichen Wettbewerbsbedingungen gegenüber Importen und verwirrenden Informationen für die Verbraucher gebremst wird.
Wenn die EU der Aquakultur wirklich wieder zu einem bedeutenden Wachstum verhelfen und ihre wichtige Rolle in einem nachhaltigen europäischen Lebensmittelsystem, einer blauen Wirtschaft und einer strategischen Lebensmittelautonomie sicherstellen will, müssen grundlegende Fragen sowohl von der Europäischen Kommission als auch darüber hinaus angegangen werden.
FEAP hat zwei Aktionsbereiche identifiziert, um die Situation zu verbessern: Ambition und Kohäsion.
(1) Die Nahrungsmittelproduktion in der EU muss zu einem Ziel mit ähnlichem Stellenwert wie der Umweltschutz werden.
Der europäische Aquakultursektor setzt sich für die Wiederherstellung und den Schutz der natürlichen Umwelt ein. Außerdem kann Aquakultur nur in Gewässern mit einem guten ökologischen Zustand betrieben werden. Aquakultur findet in öffentlichen Gewässern statt, direkt in der natürlichen Umwelt, weshalb die Umsetzung der Umweltgesetze einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Aquakultur hat. Die meisten Mitgliedstaaten (und ihre Regionen) sind jedoch mit der Umsetzung der EU-Umweltpolitik überfordert, so dass für die Entwicklung der Aquakultur in diesen Ökosystemen nur sehr wenig Raum bleibt. Es kommt vor, dass das einzige Ziel der Umweltbehörden der Mitgliedstaaten derzeit der Naturschutz und die Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen ist. Das Ergebnis ist, dass die Nahrungsmittelproduktion in der natürlichen Umwelt für diese Behörden unwichtig ist, während sie gleichzeitig den Schlüssel für die Genehmigung der Planung und Lizenzierung neuer Aquakulturanlagen in der Hand halten. Aus diesem Grund ist die Zukunft der Aquakultur in der EU düster.
Das Potenzial der Aquakultur in der EU kann nur dann ausgeschöpft werden, wenn die Nahrungsmittelproduktion in der EU zu einem Ziel mit ähnlichem Stellenwert wie der Umweltschutz wird, einschließlich der Festlegung quantitativer Produktionsziele. Die FEAP ist davon überzeugt, dass beide Ziele miteinander vereinbar sind und betont, dass die Europäische Kommission sich mit der Blauen Transformation3 der FAO befassen sollte, um die vom Europäischen Rechnungshof in seinem Sonderbericht aufgezeigten Probleme umfassend anzugehen. Die Verbesserung des derzeitigen Rechtsrahmens und die effiziente und effektive Nutzung des EMFF/EMFAF sind von untergeordneter Bedeutung, um die Stagnation der Aquakulturproduktion in der EU zu lösen. Die wichtigste Lehre, die man von der FAO ziehen kann, ist, dass die Umweltpolitik mit den Zielen der Nahrungsmittelproduktion in Einklang gebracht werden sollte.
(2) Wie die Landwirtschaft braucht auch die Aquakultur eine gemeinsame Politik
In den Verträgen der Europäischen Union wird die Aquakultur in ihrer Bedeutung nicht gleichgesetzt mit anderen Sektoren der primären Nahrungsmittelproduktion wie Landwirtschaft und Fischerei. Aus diesem Grund hat die Union noch nie eine spezifische und wirksame gemeinsame Politik für die Aquakultur definiert oder umgesetzt. Die wichtigsten EU-Instrumente zur Förderung der Entwicklung der Aquakultur sind heute die nicht verbindlichen strategischen Leitlinien, die mehrjährigen nationalen Strategiepläne der Mitgliedstaaten, der Austausch von Informationen und bewährten Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten sowie der Europäische Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds. In diesem Sinne weist der FEAP darauf hin, dass das mangelnde Wachstum des EU-Aquakultursektors seiner Ansicht nach eine direkte Folge des Fehlens einer gemeinsamen Aquakulturpolitik ist.
Die FEAP schlägt kühn vor, die politische und rechtliche Stellung der Aquakultur innerhalb der EU zu ändern und eine gemeinsame Aquakulturpolitik zu schaffen. FEAP ist der Meinung, dass dies auch durch ein spezielles Segment für die Aquakultur in der Gemeinsamen Fischereipolitik, gleichberechtigt mit der Fangfischerei, oder durch einen eigenen Abschnitt in der Gemeinsamen Agrarpolitik erreicht werden könnte. Eine Gemeinsame Aquakulturpolitik könnte den nötigen Druck ausüben, um die öffentlichen Verwaltungen anzugleichen und die technischen Engpässe bei der Raumplanung und den Genehmigungsverfahren zu beseitigen, um nur einige zu nennen.
* FEAP-Stellungnahme zu den Unzulänglichkeiten des ECA-Berichts
Einer der Mängel des ECA-Sonderberichts besteht darin, dass er sich auf die potenziellen negativen Aspekte der Aquakultur konzentriert, es aber versäumt, diese Möglichkeiten gegen die positiven Aspekte abzuwägen, und die positiven Aspekte explizit herauszustellen: effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen, geringer Kohlenstoff-Fußabdruck, geringer Verbrauch von Raum und Süßwasser und die Bereitstellung von sehr nahrhaften Lebensmitteln. Die FEAP stimmt mit der Europäischen Kommission darin überein, dass solche negativen Auswirkungen derzeit wahrscheinlich nicht in ausreichendem Maße auftreten, um den guten ökologischen Zustand von großen Meeresgebieten zu beeinträchtigen.
Die FEAP teilt mit dem ERH und der Kommission die gleichen Bedenken hinsichtlich der Bedeutung von Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Verwendung von EU-Mitteln für die Aquakultur. Dieser Verband versteht jedoch nicht, warum der ERH überrascht ist, dass fast alle förderfähigen Projekte für eine EMFF-Finanzierung ausgewählt werden. Für FEAP wäre es überraschend, dass Projekte, die die Ziele der Gemeinsamen Fischereipolitik verfolgen, nicht berücksichtigt werden.
Was schließlich die Indikatoren betrifft, so stimmt der FEAP mit dem ERH und der EK darin überein, dass es derzeit keine offiziellen Indikatoren gibt, um zu überprüfen, ob sich der Sektor nachhaltig entwickelt. In diesem Zusammenhang hat die FEAP zusammen mit dem ASC der EK eine Liste von Indikatoren für die ökologische Nachhaltigkeit 4 vorgelegt. Diese Indikatoren könnten die von der Gemeinsamen Forschungsstelle in ihren "Indikatoren für eine nachhaltige Aquakultur in der Europäischen Union "5 vorgeschlagenen Indikatoren ergänzen. Bei der Betrachtung der sozioökonomischen Indikatoren für die Entwicklung des Aquakultursektors sollten der ERH und die EK jedoch berücksichtigen, dass aufgrund der üblichen Verzögerungen bei der Genehmigung von Aquakulturanlagen und der Tatsache, dass die Fischproduktionszyklen aus biologischen Gründen Jahre dauern, immer eine beträchtliche Zeitspanne von Jahren zwischen der Genehmigung eines Projekts und dem Verkauf der Erzeugnisse auf dem Markt liegt. Es sollten Frühindikatoren für das Wachstum der Aquakultur definiert und verwendet werden, um die Wirksamkeit der Aquakulturpolitik und -finanzierung kurzfristig vorhersehen zu können.
1 https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2023-25/SR-2023-25_EN.pdf
2 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/COM-Replies-SR-2023-25/COM-Replies-SR-2023-25_EN.pdf
3 https://www.fao.org/3/cc0459en/cc0459en.pdf
4 https://www.dropbox.com/scl/fi/owvvhy3t1ulb52toefmto/221208-FEAP-Fishfarming-Technical-screening-criteria.pdf?rlkey=xpq6ycmoh9srhpoy5sqjm2p82&dl=0
5 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC75891
Originalkommentar (engl.): FEAP’s opinion about the ECA special report on the EU aquaculture policy – FEAP
Der Europäische Rechnungshof (ERH) veröffentlichte letzte Woche einen Sonderbericht über die EU-Aquakulturpolitik mit dem Titel "Stagnierende Produktion und unklare Ergebnisse trotz erhöhter EU-Finanzierung "1. Gleichzeitig veröffentlichte die Europäische Kommission eine Antwort2 auf dieses Dokument.
In seinem Bericht untersuchte der ERH, ob die Europäische Kommission (EK) und die Mitgliedstaaten (MS) die nachhaltige Entwicklung der EU-Aquakultur wirksam gefördert haben. Er kam zu dem Schluss, dass sich der strategische Rahmen der EU für die Aquakultur in den letzten Jahren zwar verbessert hat, die Aquakultur in der EU jedoch kaum gewachsen ist und es keine zuverlässigen Indikatoren gibt, um die Nachhaltigkeit des Sektors und den Beitrag der erhöhten EU-Finanzierung zur Entwicklung der EU-Aquakultur zu verfolgen.
Der ERH empfiehlt, die Mitgliedstaaten bei der Beseitigung der Hindernisse für die nachhaltige Entwicklung der EU-Aquakultur zu unterstützen, die EU-Mittel gezielter einzusetzen und die Überwachung der Leistung der EU-Mittel und der ökologischen Nachhaltigkeit zu verbessern.
In ihrer Antwort an den Rechnungshof, die zur gleichen Zeit veröffentlicht wurde, geht die Kommission auf ihre Arbeit im Bereich der Aquakultur ein, einschließlich der strategischen Leitlinien für 2021, der offenen Koordinierungsmethode, des Unterstützungsmechanismus für die Aquakultur und der teilweisen Überwachung des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) und des Europäischen Fonds für die maritime Wirtschaft, Fischerei und Aquakultur (EMFAF). Die Europäische Kommission räumt jedoch ein, dass sie im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung nicht in der Lage ist, die Wirksamkeit der Verwendung von EU-Mitteln oder, noch weiter gefasst, die ökologische Nachhaltigkeit der EU-Aquakultur insgesamt zu überwachen. Die Kommission ist der Ansicht, dass es eine solide Grundlage gibt, die es dem EU-Aquakultursektor ermöglicht, zu wachsen und sein volles Potenzial im Hinblick auf den Beitrag zu den Zielen des Europäischen Grünen Deals zu erreichen. Die Kommission ist jedoch der Ansicht, dass es noch zu früh ist, um die Ergebnisse der neuen Strategie zu bewerten.
Was die Finanzierung der Aquakultur betrifft, so stimmt die Kommission zu, dass eine solide Überwachung notwendig ist. Gleichzeitig ist sie der Ansicht, dass das Kontrollsystem des EMFAF auf der Grundlage der Erfahrungen mit dem EMFF verbessert und vereinfacht wurde.
Der FEAP ist davon überzeugt, dass die Aquakultur in der EU ein großes Potenzial für die Bereitstellung von Nahrungsmitteln aus dem Wasser, für die wirtschaftliche Entwicklung und für die Schaffung von Arbeitsplätzen hat, wie dies auch in anderen Teilen der Welt der Fall ist. Außerdem kann die derzeitige Stagnation der Aquakultur in der EU überwunden werden, wenn die richtigen Maßnahmen ergriffen werden.
Abgesehen von einigen Lücken, die der FEAP in dem Sonderbericht* des Rechnungshofs festgestellt hat, ist der FEAP der Ansicht, dass der Rechnungshof im Allgemeinen einen gründlichen Bericht vorgelegt hat, der die Situation, die Herausforderungen und die administrativen Unzulänglichkeiten der Aquakulturentwicklung in der EU beschreibt. Zu unserer größten Besorgnis hält FEAP die Antwort der Europäischen Kommission jedoch für kurzsichtig.
Die Kommission erkennt die wirklichen Gründe, die das Potenzial der Aquakultur in der EU hemmen, nicht an und bietet auch keine Lösungen an.
Der ERH hat auf eine ineffektive Raumplanung für die Aquakultur und komplizierte Genehmigungsverfahren als Gründe hingewiesen, genau wie die EK in ihren strategischen Leitlinien für 2021. In Wirklichkeit sind dies jedoch nur Symptome eines Problems und nicht die eigentlichen Ursachen für die Situation.
Die FEAP nimmt in dieser Pressemitteilung Stellung zum Sonderbericht des ECA und zur Aquakulturpolitik der EU im Allgemeinen.
FEAP stimmt mit ECA darin überein, dass sich der strategische Rahmen der EU für die Aquakultur in den letzten Jahren verbessert hat. Da es jedoch noch zu früh ist, um die Ergebnisse einer solchen neuen Strategie zu bewerten, betont dieser Verband, dass die Strategie 2021 der Europäischen Kommission nicht ausreichen wird, um das gleiche Wachstum des Sektors wie in anderen Ländern wie Norwegen, Großbritannien, der Türkei oder in vielen anderen Teilen der Welt zu erreichen.
Der ERH hat zu Recht festgestellt, dass im Zeitraum 2014-2020 in der EU nur sehr wenige neue Aquakulturbetriebe gegründet wurden, obwohl öffentliche Mittel zur Verfügung stehen. Der FEAP kann verstehen, dass der ERH möglicherweise nicht genügend Überblick hat, um diese Situation vollständig zu erklären, aber die Kommission sollte darüber Bescheid wissen. Die EU-Kommission ist sich bewusst, dass das Wachstum der Aquakultur durch übermäßigen Verwaltungsaufwand aufgrund einer übereifrigen Umsetzung von Umweltvorschriften, ungleichen Wettbewerbsbedingungen gegenüber Importen und verwirrenden Informationen für die Verbraucher gebremst wird.
Wenn die EU der Aquakultur wirklich wieder zu einem bedeutenden Wachstum verhelfen und ihre wichtige Rolle in einem nachhaltigen europäischen Lebensmittelsystem, einer blauen Wirtschaft und einer strategischen Lebensmittelautonomie sicherstellen will, müssen grundlegende Fragen sowohl von der Europäischen Kommission als auch darüber hinaus angegangen werden.
FEAP hat zwei Aktionsbereiche identifiziert, um die Situation zu verbessern: Ambition und Kohäsion.
(1) Die Nahrungsmittelproduktion in der EU muss zu einem Ziel mit ähnlichem Stellenwert wie der Umweltschutz werden.
Der europäische Aquakultursektor setzt sich für die Wiederherstellung und den Schutz der natürlichen Umwelt ein. Außerdem kann Aquakultur nur in Gewässern mit einem guten ökologischen Zustand betrieben werden. Aquakultur findet in öffentlichen Gewässern statt, direkt in der natürlichen Umwelt, weshalb die Umsetzung der Umweltgesetze einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Aquakultur hat. Die meisten Mitgliedstaaten (und ihre Regionen) sind jedoch mit der Umsetzung der EU-Umweltpolitik überfordert, so dass für die Entwicklung der Aquakultur in diesen Ökosystemen nur sehr wenig Raum bleibt. Es kommt vor, dass das einzige Ziel der Umweltbehörden der Mitgliedstaaten derzeit der Naturschutz und die Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen ist. Das Ergebnis ist, dass die Nahrungsmittelproduktion in der natürlichen Umwelt für diese Behörden unwichtig ist, während sie gleichzeitig den Schlüssel für die Genehmigung der Planung und Lizenzierung neuer Aquakulturanlagen in der Hand halten. Aus diesem Grund ist die Zukunft der Aquakultur in der EU düster.
Das Potenzial der Aquakultur in der EU kann nur dann ausgeschöpft werden, wenn die Nahrungsmittelproduktion in der EU zu einem Ziel mit ähnlichem Stellenwert wie der Umweltschutz wird, einschließlich der Festlegung quantitativer Produktionsziele. Die FEAP ist davon überzeugt, dass beide Ziele miteinander vereinbar sind und betont, dass die Europäische Kommission sich mit der Blauen Transformation3 der FAO befassen sollte, um die vom Europäischen Rechnungshof in seinem Sonderbericht aufgezeigten Probleme umfassend anzugehen. Die Verbesserung des derzeitigen Rechtsrahmens und die effiziente und effektive Nutzung des EMFF/EMFAF sind von untergeordneter Bedeutung, um die Stagnation der Aquakulturproduktion in der EU zu lösen. Die wichtigste Lehre, die man von der FAO ziehen kann, ist, dass die Umweltpolitik mit den Zielen der Nahrungsmittelproduktion in Einklang gebracht werden sollte.
(2) Wie die Landwirtschaft braucht auch die Aquakultur eine gemeinsame Politik
In den Verträgen der Europäischen Union wird die Aquakultur in ihrer Bedeutung nicht gleichgesetzt mit anderen Sektoren der primären Nahrungsmittelproduktion wie Landwirtschaft und Fischerei. Aus diesem Grund hat die Union noch nie eine spezifische und wirksame gemeinsame Politik für die Aquakultur definiert oder umgesetzt. Die wichtigsten EU-Instrumente zur Förderung der Entwicklung der Aquakultur sind heute die nicht verbindlichen strategischen Leitlinien, die mehrjährigen nationalen Strategiepläne der Mitgliedstaaten, der Austausch von Informationen und bewährten Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten sowie der Europäische Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds. In diesem Sinne weist der FEAP darauf hin, dass das mangelnde Wachstum des EU-Aquakultursektors seiner Ansicht nach eine direkte Folge des Fehlens einer gemeinsamen Aquakulturpolitik ist.
Die FEAP schlägt kühn vor, die politische und rechtliche Stellung der Aquakultur innerhalb der EU zu ändern und eine gemeinsame Aquakulturpolitik zu schaffen. FEAP ist der Meinung, dass dies auch durch ein spezielles Segment für die Aquakultur in der Gemeinsamen Fischereipolitik, gleichberechtigt mit der Fangfischerei, oder durch einen eigenen Abschnitt in der Gemeinsamen Agrarpolitik erreicht werden könnte. Eine Gemeinsame Aquakulturpolitik könnte den nötigen Druck ausüben, um die öffentlichen Verwaltungen anzugleichen und die technischen Engpässe bei der Raumplanung und den Genehmigungsverfahren zu beseitigen, um nur einige zu nennen.
* FEAP-Stellungnahme zu den Unzulänglichkeiten des ECA-Berichts
Einer der Mängel des ECA-Sonderberichts besteht darin, dass er sich auf die potenziellen negativen Aspekte der Aquakultur konzentriert, es aber versäumt, diese Möglichkeiten gegen die positiven Aspekte abzuwägen, und die positiven Aspekte explizit herauszustellen: effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen, geringer Kohlenstoff-Fußabdruck, geringer Verbrauch von Raum und Süßwasser und die Bereitstellung von sehr nahrhaften Lebensmitteln. Die FEAP stimmt mit der Europäischen Kommission darin überein, dass solche negativen Auswirkungen derzeit wahrscheinlich nicht in ausreichendem Maße auftreten, um den guten ökologischen Zustand von großen Meeresgebieten zu beeinträchtigen.
Die FEAP teilt mit dem ERH und der Kommission die gleichen Bedenken hinsichtlich der Bedeutung von Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Verwendung von EU-Mitteln für die Aquakultur. Dieser Verband versteht jedoch nicht, warum der ERH überrascht ist, dass fast alle förderfähigen Projekte für eine EMFF-Finanzierung ausgewählt werden. Für FEAP wäre es überraschend, dass Projekte, die die Ziele der Gemeinsamen Fischereipolitik verfolgen, nicht berücksichtigt werden.
Was schließlich die Indikatoren betrifft, so stimmt der FEAP mit dem ERH und der EK darin überein, dass es derzeit keine offiziellen Indikatoren gibt, um zu überprüfen, ob sich der Sektor nachhaltig entwickelt. In diesem Zusammenhang hat die FEAP zusammen mit dem ASC der EK eine Liste von Indikatoren für die ökologische Nachhaltigkeit 4 vorgelegt. Diese Indikatoren könnten die von der Gemeinsamen Forschungsstelle in ihren "Indikatoren für eine nachhaltige Aquakultur in der Europäischen Union "5 vorgeschlagenen Indikatoren ergänzen. Bei der Betrachtung der sozioökonomischen Indikatoren für die Entwicklung des Aquakultursektors sollten der ERH und die EK jedoch berücksichtigen, dass aufgrund der üblichen Verzögerungen bei der Genehmigung von Aquakulturanlagen und der Tatsache, dass die Fischproduktionszyklen aus biologischen Gründen Jahre dauern, immer eine beträchtliche Zeitspanne von Jahren zwischen der Genehmigung eines Projekts und dem Verkauf der Erzeugnisse auf dem Markt liegt. Es sollten Frühindikatoren für das Wachstum der Aquakultur definiert und verwendet werden, um die Wirksamkeit der Aquakulturpolitik und -finanzierung kurzfristig vorhersehen zu können.
1 https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2023-25/SR-2023-25_EN.pdf
2 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/COM-Replies-SR-2023-25/COM-Replies-SR-2023-25_EN.pdf
3 https://www.fao.org/3/cc0459en/cc0459en.pdf
4 https://www.dropbox.com/scl/fi/owvvhy3t1ulb52toefmto/221208-FEAP-Fishfarming-Technical-screening-criteria.pdf?rlkey=xpq6ycmoh9srhpoy5sqjm2p82&dl=0
5 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC75891
Originalkommentar (engl.): FEAP’s opinion about the ECA special report on the EU aquaculture policy – FEAP
19.11.2023
Die Aquakulturproduktion in der EU stagniert trotz Förderung
EU Rechnungshof moniert diese Entwicklung
Die Aquakultur ist ein wichtiges Element der blauen Wirtschaft in der EU und kann, wenn sie nachhaltig betrieben wird, als Proteinquelle mit einem geringeren CO2-Fußabdruck dienen. Der Rechnungshof stellte fest, dass der strategische Rahmen der EU für die Aquakultur in den letzten Jahren verbessert wurde. Einige wichtige nationale Umweltstrategien tragen der Aquakultur jedoch nicht angemessen Rechnung, und Raumplanung und Genehmigungsverfahren der Mitgliedstaaten behindern nach wie vor das Wachstum der Aquakultur. Auf eine umfangreiche Aufstockung der für die Aquakultur im Zeitraum 2014–2020 verfügbaren EU-Mittel folgten eine relativ geringe Mittelausschöpfung und wenig anspruchsvolle Projektauswahlkriterien. Die Aquakultur in der EU verzeichnete in diesem Zeitraum wenig Wachstum, und es gibt keine zuverlässigen Indikatoren, um die Nachhaltigkeit des Sektors zu überwachen oder den Beitrag der aufgestockten EU-Mittel zu verfolgen.
Der Bericht des Rechnungshofs sowie die Antwort der Kommission sind als Download (deutsch) beigefügt.
Weitere Infos: hier
Der Bericht des Rechnungshofs sowie die Antwort der Kommission sind als Download (deutsch) beigefügt.
Weitere Infos: hier
02.11.2023
Europäischer Meeres-/Fischerei- und Aquakulturfonds wird in Bayern fortgeführt und verbessert
17,7 Mio. € stehen bereit
Erfolgreiches Fischerei-Förderprogramm wird fortgesetzt und weiter verbessert
München – In Bayern hat die Fischereiwirtschaft eine lange Tradition. Rund 10.000 Familienbetriebe bewirtschaften seit Generationen die Gewässer im Freistaat. Neben der Versorgung mit gesunden regionalen Lebensmitteln in hervorragender Qualität hat gerade auch die Teichwirtschaft eine enorme Bedeutung für Biodiversität und Landschaftsbild. Bayern steht seit jeher fest an der Seite seiner Fisch- und Teichwirte. Mit dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) ist nun ein neues Förderprogramm gestartet.
"Wir unterstützen die Betriebe dabei, in eine nachhaltige Zukunft zu investieren. Mit dem erhöhten Fördersatz für Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter unter 40 Jahren wollen wir vor allem die junge Generation anspornen, Betriebe zu übernehmen und weiterzuführen. In Bayern ist die traditionelle Fischerei- und Teichwirtschaft fest verwurzelt und das soll auch so bleiben," so Agrarministerin Kaniber.
Der Ministerin zufolge stehen für die Förderung EU- und Landesmittel in Höhe von 17,7 Millionen Euro bereit. Neben der Erhöhung der Förderbeträge pro Betrieb wird vor allem der Fördersatz für Schutzmaßnahmen gegen fischfressende Wildtiere angehoben. Zukünftig werden zum Beispiel für Fischotterzäune oder Abwehrnetze gegen Kormorane 60 Prozent Zuschuss ausbezahlt.
Schutzmaßnahmen sind aber nicht überall möglich oder wirtschaftlich sinnvoll. "Bei ernsten Schäden durch Fischotter müssen wir in Gebieten, in denen der Erhaltungszustand dieser Art nicht gefährdet ist, weitergehende Maßnahmen ergreifen. Indem wir die rechtlichen Rahmenbedingungen für Entnahmen schaffen, ohne dabei den Artenschutz zu missachten, setzen wir ein klares Zeichen. Wir stehen hinter unseren Betrieben und wollen unsere bayerische Teichkulturlandschaft erhalten.", stellte die Ministerin klar.
Der EMFAF ist das Nachfolgeprogramm des jetzt zu Ende gehenden Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF), das aus Sicht der Staatsregierung ein großer Erfolg war. So wurden in den Jahren 2016 bis 2023 in Bayern 861 Vorhaben mit einer Investitionssumme von insgesamt über 29 Millionen Euro bewilligt, mit einem Schwerpunkt im Bereich der Aquakultur. Knapp 72 Prozent aller Vorhaben wurden von Fischzucht- und Teichwirtschaftsbetrieben beantragt. Mit dem EMFF-Programm konnten in der vergangenen Förderperiode insgesamt 15 Millionen Euro Zuwendungen für überbetriebliche und betriebliche Vorhaben bewilligt werden. 75 Prozent davon stammen aus EU-Mitteln, 25 Prozent übernimmt der Freistaat. Damit wurde ein wichtiger Beitrag geleistet, um den Fischerei- und Teichwirtschaftsbetrieben zukunftsweisende Investitionen zu ermöglichen, beispielsweise der Aufbau von Direktvermarkungen.
Die Bayerische Staatsregierung hat das EMFF-Programm zudem genutzt, um den Teichwirtschaftsbetrieben mit einer eigens konzipierten "Krisenbeihilfe" zu unterstützen. Damit konnten die Kostensteigerungen, die der Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst hatte, teilweise ausgeglichen werden. Dafür hatte die EU-Kommission die EMFF-Verordnung extra geändert. Bayern hat als eines von sieben Bundesländern diese Möglichkeit ergriffen und eine eigene Richtlinie für derartige Ausgleichszahlungen erlassen.
Neben den betrieblichen Investitionen wurde aus dem EMFF auch die Entwicklung von vier sogenannten Fischwirtschaftsgebieten (FLAG) gefördert, die besonders stark durch Teichwirtschaft geprägt sind. In Bayern waren das in der vergangenen Förderperiode die Landkreise beziehungsweise Fischwirtschaftsgebiete Tirschenreuth, Schwandorf, Ansbach und Aischgrund.
Weitere Informationen zum EMFAF erhalten Sie unter folgendem Link: www.stmelf.bayern.de/foerderung/europaeischer-meeres-fischerei-und/index.html
München – In Bayern hat die Fischereiwirtschaft eine lange Tradition. Rund 10.000 Familienbetriebe bewirtschaften seit Generationen die Gewässer im Freistaat. Neben der Versorgung mit gesunden regionalen Lebensmitteln in hervorragender Qualität hat gerade auch die Teichwirtschaft eine enorme Bedeutung für Biodiversität und Landschaftsbild. Bayern steht seit jeher fest an der Seite seiner Fisch- und Teichwirte. Mit dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) ist nun ein neues Förderprogramm gestartet.
"Wir unterstützen die Betriebe dabei, in eine nachhaltige Zukunft zu investieren. Mit dem erhöhten Fördersatz für Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter unter 40 Jahren wollen wir vor allem die junge Generation anspornen, Betriebe zu übernehmen und weiterzuführen. In Bayern ist die traditionelle Fischerei- und Teichwirtschaft fest verwurzelt und das soll auch so bleiben," so Agrarministerin Kaniber.
Der Ministerin zufolge stehen für die Förderung EU- und Landesmittel in Höhe von 17,7 Millionen Euro bereit. Neben der Erhöhung der Förderbeträge pro Betrieb wird vor allem der Fördersatz für Schutzmaßnahmen gegen fischfressende Wildtiere angehoben. Zukünftig werden zum Beispiel für Fischotterzäune oder Abwehrnetze gegen Kormorane 60 Prozent Zuschuss ausbezahlt.
Schutzmaßnahmen sind aber nicht überall möglich oder wirtschaftlich sinnvoll. "Bei ernsten Schäden durch Fischotter müssen wir in Gebieten, in denen der Erhaltungszustand dieser Art nicht gefährdet ist, weitergehende Maßnahmen ergreifen. Indem wir die rechtlichen Rahmenbedingungen für Entnahmen schaffen, ohne dabei den Artenschutz zu missachten, setzen wir ein klares Zeichen. Wir stehen hinter unseren Betrieben und wollen unsere bayerische Teichkulturlandschaft erhalten.", stellte die Ministerin klar.
Der EMFAF ist das Nachfolgeprogramm des jetzt zu Ende gehenden Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF), das aus Sicht der Staatsregierung ein großer Erfolg war. So wurden in den Jahren 2016 bis 2023 in Bayern 861 Vorhaben mit einer Investitionssumme von insgesamt über 29 Millionen Euro bewilligt, mit einem Schwerpunkt im Bereich der Aquakultur. Knapp 72 Prozent aller Vorhaben wurden von Fischzucht- und Teichwirtschaftsbetrieben beantragt. Mit dem EMFF-Programm konnten in der vergangenen Förderperiode insgesamt 15 Millionen Euro Zuwendungen für überbetriebliche und betriebliche Vorhaben bewilligt werden. 75 Prozent davon stammen aus EU-Mitteln, 25 Prozent übernimmt der Freistaat. Damit wurde ein wichtiger Beitrag geleistet, um den Fischerei- und Teichwirtschaftsbetrieben zukunftsweisende Investitionen zu ermöglichen, beispielsweise der Aufbau von Direktvermarkungen.
Die Bayerische Staatsregierung hat das EMFF-Programm zudem genutzt, um den Teichwirtschaftsbetrieben mit einer eigens konzipierten "Krisenbeihilfe" zu unterstützen. Damit konnten die Kostensteigerungen, die der Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst hatte, teilweise ausgeglichen werden. Dafür hatte die EU-Kommission die EMFF-Verordnung extra geändert. Bayern hat als eines von sieben Bundesländern diese Möglichkeit ergriffen und eine eigene Richtlinie für derartige Ausgleichszahlungen erlassen.
Neben den betrieblichen Investitionen wurde aus dem EMFF auch die Entwicklung von vier sogenannten Fischwirtschaftsgebieten (FLAG) gefördert, die besonders stark durch Teichwirtschaft geprägt sind. In Bayern waren das in der vergangenen Förderperiode die Landkreise beziehungsweise Fischwirtschaftsgebiete Tirschenreuth, Schwandorf, Ansbach und Aischgrund.
Weitere Informationen zum EMFAF erhalten Sie unter folgendem Link: www.stmelf.bayern.de/foerderung/europaeischer-meeres-fischerei-und/index.html
20.10.2023
Studie zu Auswirkungen des Klimawandels und generellen Stressfaktoren auf die Karpfenteichwirtschaft
Im Rahmen seiner Doktorarbeit erforscht Hr. Maximilian Brönner die Auswirkungen des Klimawandels und generellen Stressfaktoren auf die Karpfenteichwirtschaft.
Teichwirte/innen sowie alle mit einem erweiterten Fachwissen in Bezug auf die Karpfenteichwirtschaft können ihre Erfahrungen mittels Onlinefragebogen einbringen.
Hier gehts direkt zum Fragebogen
Link für Deutschland: https://fau.questionpro.eu/t/AB3usalZB3viXA
Link für Österreich: https://fau.questionpro.eu/t/AB3usalZB3vkYi
Link für die europäische Version (engl.): https://fau.questionpro.eu/t/AB3usalZB3vlT7
Weitere Infos:
Um was geht es: In dieser Online-Befragung werden primär die Auswirkungen des Klimawandels auf die
Karpfenteichwirtschaft in Deutschland und deren mögliche Anpassungsstrategien erhoben. Neben klimatischen
Faktoren stehen auch weitere Stressfaktoren, wie beispielsweise die Prädationsproblematik, im Fokus der
Untersuchung.
Teichwirte/innen sowie alle mit einem erweiterten Fachwissen in Bezug auf die Karpfenteichwirtschaft können ihre Erfahrungen mittels Onlinefragebogen einbringen.
Hier gehts direkt zum Fragebogen
Link für Deutschland: https://fau.questionpro.eu/t/AB3usalZB3viXA
Link für Österreich: https://fau.questionpro.eu/t/AB3usalZB3vkYi
Link für die europäische Version (engl.): https://fau.questionpro.eu/t/AB3usalZB3vlT7
Weitere Infos:
Um was geht es: In dieser Online-Befragung werden primär die Auswirkungen des Klimawandels auf die
Karpfenteichwirtschaft in Deutschland und deren mögliche Anpassungsstrategien erhoben. Neben klimatischen
Faktoren stehen auch weitere Stressfaktoren, wie beispielsweise die Prädationsproblematik, im Fokus der
Untersuchung.
- Wer führt die Befragung durch? Die Online-Befragung wurde im Rahmen des Promotionsvorhabens von Maximilian Brönner entwickelt, welcher an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg als Doktorand zu diesen Themen in der Karpfenteichregion Aischgrund forscht.
- Wer wird befragt? Diese Befragung richtet sich einerseits an Karpfenteichbewirtschaftende in ganz Deutschland sowie andererseits an Expertinnen/Experten, die in diesem Feld tätig sind. Hier sind jegliche Betriebsformen (z.B. Haupt-, Neben-, Freizeiterwerb) sowie externe fachliche Expertisen rund um das Thema der Karpfenteichwirtschaft erwünscht!
- Was passiert mit Ihren Angaben? Ihre Antworten dienen ausschließlich Forschungszwecken. Sie werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Direkte Rückschlüsse auf Ihre Person sind nicht möglich. Diese Erhebung unterliegt der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
- Wie lange dauert die Befragung? Die Beantwortung dauert ca. 20-30 Minuten.
- Sie kennen weitere Personen, die sich für diese Erhebung ebenso interessierten könnten?
17.10.2023
Änderung der Deminimis Regelung
Die Europäische Kommission hat eine Änderung der sogenannten "De-minimis"-Verordnung für den Fischerei- und Aquakultursektor ("Fischerei-De-minimis-Verordnung") angenommen. Die geänderte Verordnung, mit der geringe Beihilfebeträge von der Kontrolle staatlicher Beihilfen ausgenommen werden, da davon ausgegangen wird, dass sie keine Auswirkungen auf den Wettbewerb und den Handel im Binnenmarkt haben, tritt 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. Die Entscheidung, ob die Regelung Anwendung findet obliegt den jeweiligen Mitgliedsstaaten.
Die Änderung der De-minimis-Verordnung für den Fischereisektor umfasst die folgenden Änderungen:
- Anhebung des Höchstbetrags der De-minimis-Beihilfen pro Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren von 30.000 € auf 40.000 €, vorbehaltlich der Einrichtung eines zentralen nationalen Registers.
- Nur die Primärproduktion von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen fällt weiterhin unter die Fischerei-De-minimis-Verordnung, während die Verarbeitung und Vermarktung dieser Erzeugnisse unter die allgemeine De-minimis-Verordnung fällt.
- Die Verlängerung der Geltungsdauer der überarbeiteten Fischerei-De-minimis-Verordnung bis zum 31. Dezember 2029.
Weitere Infos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4728?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=MARE%20Newsletter
Die Änderung der De-minimis-Verordnung für den Fischereisektor umfasst die folgenden Änderungen:
- Anhebung des Höchstbetrags der De-minimis-Beihilfen pro Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren von 30.000 € auf 40.000 €, vorbehaltlich der Einrichtung eines zentralen nationalen Registers.
- Nur die Primärproduktion von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen fällt weiterhin unter die Fischerei-De-minimis-Verordnung, während die Verarbeitung und Vermarktung dieser Erzeugnisse unter die allgemeine De-minimis-Verordnung fällt.
- Die Verlängerung der Geltungsdauer der überarbeiteten Fischerei-De-minimis-Verordnung bis zum 31. Dezember 2029.
Weitere Infos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4728?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=MARE%20Newsletter
03.07.2023
Sechste Internationale Karpfenkonferenz in Ungarn 30.08. bis 02.09.2023
Nach einer coronabedingten Pause findet die internationale Karpfenkonferenz 2023 wieder statt. Veranstaltungsort ist Szarvas in Ungarn. Die Gegend um Szarvas ist seit Jahrhunderten ein wichtiges Teichwirtschaftsgebiet. Die erzeugte Hauptfischart ist natürlich der Karpfen. Neben der Karpfenkonferent findet auch noch das Fischfestival statt, dort können die Besucher ungarische Fischspezialitäten probieren.
Themen sind v.a. die Chancen und Risiken der Karpfenerzeugung sowie die Bedeutung des Karpfens bei internationalen Organisationen wie FAO oder UNESCO.
Das Programm finden Sie hier
Themen sind v.a. die Chancen und Risiken der Karpfenerzeugung sowie die Bedeutung des Karpfens bei internationalen Organisationen wie FAO oder UNESCO.
Das Programm finden Sie hier
26.06.2023
Neue Studie zum Tierwohl von Fischen vorgestellt
Eine neue Studie untersucht das Wohlergehen der wichtigsten Fischarten, die in der Europäischen Union gezüchtet werden, und beleuchtet den derzeitigen Wissensstand über das Wohlergehen von Fischen, Wissenslücken, Bedürfnisse von Fischen und Haltungsmethoden, die für das Wohlergehen von Fischen von Bedeutung sind. Die Studie konzentriert sich auf Produktionssysteme und Produktionsphasen in einer artspezifischen Weise. Die Untersuchung umfasst eine Literaturrecherche, eine Bewertung des rechtlichen Rahmens, eine Konsultation der Interessengruppen, Fallstudien und eine SWOT-Analyse. Es werden Schlussfolgerungen und politische Empfehlungen gegeben, die für die Entscheidungsfindung der EU relevant sind.
Die Studie ist im Original (engl.) beigefügt. Eine Zusammenfassung im Original und als deutsche Übersetzung.
Die Studie ist im Original (engl.) beigefügt. Eine Zusammenfassung im Original und als deutsche Übersetzung.
25.06.2023
Ab 2024 dreijähriges Fangverbot für Felchen am Bodensee
Bayern zieht die Notbremse und setzt Befristung durch!
Die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) beschließt aufgrund des massiven Einbruchs des Felchenbestands ein Maßnahmenpaket.
Im Jahr 2022 wurden im Bodensee lediglich 21 Tonnen Felchen gefangen. Dies entspricht einem Einbruch um 80% gegenüber dem Jahr 2021. Der Felchenbestand leidet unter einem Mangel an Nahrung sowie unter dem hohen Prädatorendruck durch Kormorane. Neben dem Fangverbot umfasst das Maßnahmenpaket noch den Besatz mit Jungfelchen und Versuche den gebietsfremden Stichling einzudämmen.
Weitere Infos:
Willkommen | Landespressestelle Land Vorarlberg
Ab 2024: Fangverbot für Felchen im Bodensee - BLINKER
Im Jahr 2022 wurden im Bodensee lediglich 21 Tonnen Felchen gefangen. Dies entspricht einem Einbruch um 80% gegenüber dem Jahr 2021. Der Felchenbestand leidet unter einem Mangel an Nahrung sowie unter dem hohen Prädatorendruck durch Kormorane. Neben dem Fangverbot umfasst das Maßnahmenpaket noch den Besatz mit Jungfelchen und Versuche den gebietsfremden Stichling einzudämmen.
Weitere Infos:
Willkommen | Landespressestelle Land Vorarlberg
Ab 2024: Fangverbot für Felchen im Bodensee - BLINKER
23.06.2023
YFM im Austausch mit Landtagsfraktion der Grünen
Christian Hierneis und Anna Schwamberger besichtigen die Fischzucht Stier
Die Mitglieder der Grünen Landtagsfraktion Bayern Christian Hierneis und Anna Schwamberger besichtigten am 07.Juni.2023 den Fischzuchtbetrieb Stier. Neben erfahrenen Kollegen aus dem Landkreis Tirschenreuth waren auch die Young Fishermen vertreten, um mit den Abgeordneten über die Zukunft der Fischerei in Bayern zu diskutieren.
Viele Fischereibetriebe stehen vor dem Generationswechsel und für die jungen Betriebsnachfolger stellt sich häufig die Frage, ob die traditionelle Wirtschaftsweise Zukunft hat. Vor den Hintergrund des Prädatorendrucks und Klimawandels müssen sich die Betriebe anpassen. So wird bei der Fischzucht Stier bereits jetzt ein großer Teil der Produktion in Kreislaufanlagen erzeugt.
Andererseits gibt es weiterhin Bestrebungen die traditionellen Teichwirtschaften weiterzuführen, auch um die Kulturlandschaft und die, von Teichen ausgehenden, Ökosystemdienstleistungen zu erhalten.
Den Abgeordneten wurde näher gebracht, dass beide Wirtschaftsweisen (Kreislauftechnik und traditionelle Bewirtschaftung) nötig sind, um weiterhin regionale, hochwertige Lebensmittel zu produzieren und die wertvollen Landschaften rund um die Teiche zu erhalten.
Viele Fischereibetriebe stehen vor dem Generationswechsel und für die jungen Betriebsnachfolger stellt sich häufig die Frage, ob die traditionelle Wirtschaftsweise Zukunft hat. Vor den Hintergrund des Prädatorendrucks und Klimawandels müssen sich die Betriebe anpassen. So wird bei der Fischzucht Stier bereits jetzt ein großer Teil der Produktion in Kreislaufanlagen erzeugt.
Andererseits gibt es weiterhin Bestrebungen die traditionellen Teichwirtschaften weiterzuführen, auch um die Kulturlandschaft und die, von Teichen ausgehenden, Ökosystemdienstleistungen zu erhalten.
Den Abgeordneten wurde näher gebracht, dass beide Wirtschaftsweisen (Kreislauftechnik und traditionelle Bewirtschaftung) nötig sind, um weiterhin regionale, hochwertige Lebensmittel zu produzieren und die wertvollen Landschaften rund um die Teiche zu erhalten.
22.06.2023
Ergebnisse des Nationalen Tierwohlmonitoring vorgestellt
Die nach außen gezeigte Zufriedenheit der Projektleiter auf dem Podium wurde von den Zuhörern durchaus nicht geteilt
Am 22.Juli hat in Berlin die Abschlußveranstaltung zum Nationalen Tierwohl Monitoring ( NaTiMon) stattgefunden. Dieses Projekt umfaßt alle in Deutschland gehaltenen Nutztierarten. Für die Aquakultur wurde die Forelle und der Karpfen in das Projekt aufgenommen. Die nach aussen gezeigte Zufriedenheit der Projektleiter auf dem Podium wurde von den Zuhörern durchaus nicht geteilt. Für die Fische wurde trotz Hinweis und Nachfrage aus dem Publikum jegliche Einbeziehung des Prädatorendruckes in das System und die Leiden unserer Tiere dadurch, abgelehnt.
Die Anonymisierung der Daten wird von den Praktikern im Auditorium für illusorisch gehalten, d.h. zumindest in den Hauptbereichen des Tierwohlmonitorings wie Geflügelhaltung, Rinder- und Schweinehaltung, wird man diesem Anspruch nicht gerecht werden können. In wieweit die Aquakultur betroffen ist, kann zumindest aus dieser Veranstaltung nicht abschließend beurteilt werden. In jedem Fall handelt es sich um ein Vorhaben, das von Tierschutzverbänden, dem BMEL, in Person der Staastsekretärin (GRÜNE) vorangetrieben wird und auf das man nur sehr wenig Einfluß hat, da es von Bundesforschungseinrichtungen konzipiert, und umgesetzt wird. Ein Grund mehr die Entwicklung im Bereich Aquakultur sehr genau zu verfolgen und auch untereinander rechtzeitig zu kommunizieren. Die Diskussion Tierwohl endet bei den Staatsvertretern und bei den von öffentlichen Geldern bezahlten Forschern, an der Kollision mit dem Naturschutz, die Prädatoren sind heilige Kühe, auch wenn sie an der Spitze der Pyramide des Systems stehen und massive Einbrüche auch in die Bestände anderer geschützter Arten bedeuten, nicht nur in unser Eigentum. - B. Feneis, Präsident VDBA
Als Download finden Sie die Pressemitteilung des BMEL und den Abschlussbericht "Aquakultur"
Weitere Infos zum Nationalen Tierwohlmonitoring gibt es auf der offiziellen Homepage
Die Anonymisierung der Daten wird von den Praktikern im Auditorium für illusorisch gehalten, d.h. zumindest in den Hauptbereichen des Tierwohlmonitorings wie Geflügelhaltung, Rinder- und Schweinehaltung, wird man diesem Anspruch nicht gerecht werden können. In wieweit die Aquakultur betroffen ist, kann zumindest aus dieser Veranstaltung nicht abschließend beurteilt werden. In jedem Fall handelt es sich um ein Vorhaben, das von Tierschutzverbänden, dem BMEL, in Person der Staastsekretärin (GRÜNE) vorangetrieben wird und auf das man nur sehr wenig Einfluß hat, da es von Bundesforschungseinrichtungen konzipiert, und umgesetzt wird. Ein Grund mehr die Entwicklung im Bereich Aquakultur sehr genau zu verfolgen und auch untereinander rechtzeitig zu kommunizieren. Die Diskussion Tierwohl endet bei den Staatsvertretern und bei den von öffentlichen Geldern bezahlten Forschern, an der Kollision mit dem Naturschutz, die Prädatoren sind heilige Kühe, auch wenn sie an der Spitze der Pyramide des Systems stehen und massive Einbrüche auch in die Bestände anderer geschützter Arten bedeuten, nicht nur in unser Eigentum. - B. Feneis, Präsident VDBA
Als Download finden Sie die Pressemitteilung des BMEL und den Abschlussbericht "Aquakultur"
Weitere Infos zum Nationalen Tierwohlmonitoring gibt es auf der offiziellen Homepage
04.06.2023
YFM in Indien
Young Fishermen auf dem Weg zu einem der größten Aquakulturproduzenten der Welt
Als Vertreter der jungen Generation Fischer/innen besuchten Katharina Böckl und Josef Stier, zusammen mit dem VDBA Präsidenten Bernhard Feneis Indien. Der Subkontinent ist einer der größten Aquakulturproduzenten weltweit. In einem internationalen Workshop wurden die Chancen der Aquakultur im Hinblick auf zukünftige Herausforderungen erörtert.
Der ausführliche Bericht ist als Download beigefügt.
Der ausführliche Bericht ist als Download beigefügt.
04.06.2023
YFM goes Bayerische Jungbauernschaft
Die BJB informiert sich am Fischhof Hausman über die Teichwirtschaft
Teichwirtschaft – Eine Nische in der Landwirtschaft
Im April durften wir im Rahmen der Vortragsreihe des Arbeitskreis Agrarpolitik der Bayerischen Jungbauernschaft (BJB) auf dem Fischhof der Familie Hausmann zu Gast sein. Bei einer Betriebsführung erklärten Franz und Hans Hausmann (Young Fishermen – VDBA) die Produktion von Speisekarpfen und zeigten uns direkt vor Ort sehr anschaulich, wo und wie die verschiedenen Produktionsschritte ablaufen. Zunächst wird in einer Kreislaufanlage die Fischbrut erzeugt, welche anschließend in Vorstreckteichen heranwächst. Nach dem ersten Sommer haben die sogenannten K1 eine Größe von ca. 8 cm. Im zweiten Jahr können bereits Setzlinge (K2) in Handflächengröße gefischt werden. Nach dem dritten Sommer werden die Speisekarpfen (K3) auf verschiedene Wege verarbeitet und vermarktet. Besonders hervorzuheben sind die Verkaufsautomaten und der eigene Hofladen, in denen die feinsten Fischspezialitäten vom frischen oder geräucherten Fisch bis hin zu Burgerpatties und grillfertigem Filet für den Kunden bereitstehen.
Nach der Führung durften wir im Glaspavillon neben Karpfen auch andere leckere und vor allem hausgemachte Fischprodukte wie Lachsforelle oder Saibling probieren. Im Vortrag von Herrn Bernhard Feneis, dem Präsidenten des Verbands der Deutschen Binnenfischerei und Aquakultur (VDBA), ging es nun nach der Praxis im Betrieb um die Strukturen in der Fischerei sowie die Zusammenhänge zwischen Fischerei und Landwirtschaft bis zur EU nach Brüssel. Die anschließende Diskussion zeigte, dass die Teichwirtschaft neben den Chancen, wie der naturnahen Fütterung des Karpfens, den Wasserrückhalt der Teiche und deren Beitrag zur Biodiversität auch vor großen Herausforderungen steht. Hierzu zählen vor allem hohe Verluste durch Prädatoren wie den Fischotter oder Kormoran. Auch der Klimawandel und die damit einhergehende Wasserknappheit sowie Sauerstoffmangel bei erhöhten Wassertemperaturen stellen eine zukünftige Herausforderung dar.
Die hohe Teilnehmerzahl der Veranstaltung zeigt, dass die Teichwirtschaft als kleiner und hoch spezialisierter Bereich der Landwirtschaft durchaus auf Interesse trifft und wahrgenommen wird. In den kommenden Monaten plant der Arbeitskreis Agrarpolitik ein Positionspapier zum Thema Teichwirtschaft.
Ein herzliches Dankeschön gilt besonders der Familie Hausmann und Herrn Bernhard Feneis für die vielen neuen Eindrücke und Einblicke in die Karpfenteichwirtschaft.
Im April durften wir im Rahmen der Vortragsreihe des Arbeitskreis Agrarpolitik der Bayerischen Jungbauernschaft (BJB) auf dem Fischhof der Familie Hausmann zu Gast sein. Bei einer Betriebsführung erklärten Franz und Hans Hausmann (Young Fishermen – VDBA) die Produktion von Speisekarpfen und zeigten uns direkt vor Ort sehr anschaulich, wo und wie die verschiedenen Produktionsschritte ablaufen. Zunächst wird in einer Kreislaufanlage die Fischbrut erzeugt, welche anschließend in Vorstreckteichen heranwächst. Nach dem ersten Sommer haben die sogenannten K1 eine Größe von ca. 8 cm. Im zweiten Jahr können bereits Setzlinge (K2) in Handflächengröße gefischt werden. Nach dem dritten Sommer werden die Speisekarpfen (K3) auf verschiedene Wege verarbeitet und vermarktet. Besonders hervorzuheben sind die Verkaufsautomaten und der eigene Hofladen, in denen die feinsten Fischspezialitäten vom frischen oder geräucherten Fisch bis hin zu Burgerpatties und grillfertigem Filet für den Kunden bereitstehen.
Nach der Führung durften wir im Glaspavillon neben Karpfen auch andere leckere und vor allem hausgemachte Fischprodukte wie Lachsforelle oder Saibling probieren. Im Vortrag von Herrn Bernhard Feneis, dem Präsidenten des Verbands der Deutschen Binnenfischerei und Aquakultur (VDBA), ging es nun nach der Praxis im Betrieb um die Strukturen in der Fischerei sowie die Zusammenhänge zwischen Fischerei und Landwirtschaft bis zur EU nach Brüssel. Die anschließende Diskussion zeigte, dass die Teichwirtschaft neben den Chancen, wie der naturnahen Fütterung des Karpfens, den Wasserrückhalt der Teiche und deren Beitrag zur Biodiversität auch vor großen Herausforderungen steht. Hierzu zählen vor allem hohe Verluste durch Prädatoren wie den Fischotter oder Kormoran. Auch der Klimawandel und die damit einhergehende Wasserknappheit sowie Sauerstoffmangel bei erhöhten Wassertemperaturen stellen eine zukünftige Herausforderung dar.
Die hohe Teilnehmerzahl der Veranstaltung zeigt, dass die Teichwirtschaft als kleiner und hoch spezialisierter Bereich der Landwirtschaft durchaus auf Interesse trifft und wahrgenommen wird. In den kommenden Monaten plant der Arbeitskreis Agrarpolitik ein Positionspapier zum Thema Teichwirtschaft.
Ein herzliches Dankeschön gilt besonders der Familie Hausmann und Herrn Bernhard Feneis für die vielen neuen Eindrücke und Einblicke in die Karpfenteichwirtschaft.
08.04.2023
Grundschleppnetzverbot: Landwirtschaftsminister unterstützen Küstenfischer
Angesichts neuer EU-Pläne für eine nachhaltigere Fischerei sehen Fischer an der deutschen Nordseeküste ihre Existenz in Gefahr. Vor allem ein geplantes Verbot von sogenannten Grundschleppnetzen in Meeresschutzgebieten, mit denen etwa Krabben gefischt werden, würde aus Sicht der Fischer das Aus vieler Betriebe bedeuten.
Die Landesregierungen in Kiel und Hannover sind sich einig, dass die Pläne nicht nur die Fischerei treffen würde: »Ein Verbot würde nicht nur viele berufliche Existenzen vernichten, sondern auch erhebliche sozioökonomische Auswirkungen weit über die Fischerei hinaus verursachen. Wir brauchen hier einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Schutz und Nutzung«, sagt Fischereiminister Werner Schwarz (CDU).
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben daher bereits ein gemeinsames Ministerschreiben an das Bundeslandwirtschaftsministerium gerichtet, in dem auf die katastrophalen Folgen eines solchen Verbots für die Küstenfischerei hingewiesen wird. Sie bitten den Bund, sich bei den weiteren Abstimmungen auf EU-Ebene gegen ein pauschales Verbot jeglicher grundberührender Fischerei in Meeresschutzgebieten auszusprechen. Auf der Agrarministerkonferenz in Büsum wollen die beiden Länder dazu auch einen Antrag einbringen.
Weitere Infos: Verbot von Grundschleppnetzen: Beschließt Europa das Ende der Krabbenbrötchen? - DER SPIEGEL
Bild: Fischer Nils Sander zeigt Ministerin Miriam Staudte ein Siebnetz. Quelle: ML
Die Landesregierungen in Kiel und Hannover sind sich einig, dass die Pläne nicht nur die Fischerei treffen würde: »Ein Verbot würde nicht nur viele berufliche Existenzen vernichten, sondern auch erhebliche sozioökonomische Auswirkungen weit über die Fischerei hinaus verursachen. Wir brauchen hier einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Schutz und Nutzung«, sagt Fischereiminister Werner Schwarz (CDU).
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben daher bereits ein gemeinsames Ministerschreiben an das Bundeslandwirtschaftsministerium gerichtet, in dem auf die katastrophalen Folgen eines solchen Verbots für die Küstenfischerei hingewiesen wird. Sie bitten den Bund, sich bei den weiteren Abstimmungen auf EU-Ebene gegen ein pauschales Verbot jeglicher grundberührender Fischerei in Meeresschutzgebieten auszusprechen. Auf der Agrarministerkonferenz in Büsum wollen die beiden Länder dazu auch einen Antrag einbringen.
Weitere Infos: Verbot von Grundschleppnetzen: Beschließt Europa das Ende der Krabbenbrötchen? - DER SPIEGEL
Bild: Fischer Nils Sander zeigt Ministerin Miriam Staudte ein Siebnetz. Quelle: ML
08.04.2023
Nationales Tierwohl-Monitoring in der Aquakultur
Einladung zur öffentlichen online Veranstaltung
Das Thünen Institut lädt am 21.04.2023, um 14:00 Uhr zu einer öffentlichen online-Veranstaltung. Thema ist das NaTiMon – Ergebnisse und Erfahrungen zur Erhebung von Tierwohl-Indikatoren auf den Betrieben.
Vorgestellt werden sollen eine Auswahl an Indikatoren, die das Tierwohl in der Karpfen- und Forellenproduktion wiederspiegeln sollen.
Den Link zur Teilnahme finden Sie in beigefügtem Dokument.
Vorgestellt werden sollen eine Auswahl an Indikatoren, die das Tierwohl in der Karpfen- und Forellenproduktion wiederspiegeln sollen.
Den Link zur Teilnahme finden Sie in beigefügtem Dokument.
08.04.2023
Die Leopoldina veranstaltet einen Workshop zur Nachhaltigen Aquakultur
Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sucht acht Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler mit herausragendem Profil für den Workshop "Sustainable Aquaculture - Environmental Impacts and Food Security", der vom 16. bis 19. Oktober 2023 in Berlin stattfindet. Der Workshop wird gemeinsam mit der Academia Brasileira de Ciências (ABC) organisiert. Ziel des Workshops ist es, aktuelle und neue Herausforderungen und Bedürfnisse im Bereich der nachhaltigen Aquakultur zu untersuchen, zu bewerten und zu diskutieren. Das Ergebnis wird ein Strategiepapier sein, das von beiden Akademien veröffentlicht und verteilt wird.
Details zum Bewerbungsverfahren finden Sie in beigefügtem Dokument (engl.).
Details zum Bewerbungsverfahren finden Sie in beigefügtem Dokument (engl.).
15.02.2023
Young Fishermen bei Staatsministerin Kaniber
Bild (v.l.n.r.): Kevin Pommerenke, Franz Hausmann, Andreas Wagner, Katharina Böckl, Staatsministerin Michaela Kaniber, Hans Hausmann, Anna Klupp, Dr. Reinhard Reiter, Josef Stier
Einige Mitglieder der Young Fishermen, der Jungendorganisation des VDBA, waren am 31.01.2023 zum Gespräch mit der Bayerischen Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eingeladen. Frau Kaniber nahm sich Zeit, um die nächste Generation Teichwirte/-innen kennenzulernen und diskutierte die Anliegen der jungen Generation in Sachen Fischereipolitik.
Die Wünsche der Young Fishermen wurden in einem Positionspapier (s. Download) dargestellt und an Frau Kaniber übergeben.
Einige Mitglieder der Young Fishermen, der Jungendorganisation des VDBA, waren am 31.01.2023 zum Gespräch mit der Bayerischen Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eingeladen. Frau Kaniber nahm sich Zeit, um die nächste Generation Teichwirte/-innen kennenzulernen und diskutierte die Anliegen der jungen Generation in Sachen Fischereipolitik.
Die Wünsche der Young Fishermen wurden in einem Positionspapier (s. Download) dargestellt und an Frau Kaniber übergeben.
12.01.2023
Krisenbeihilfe für Bayerische Fischereibetriebe möglich
m EMFF können Aquakulturbetriebe ab 11.01.2023 bis 15.03.2023 bei der Bewilligungsbehörde (Kompetenzzentrum Förderprogramme der FüAk in Marktredwitz) die „Krisenbeihilfe“ beantragen.
Aquakulturbetriebe können einen Antrag auf Ausgleichszahlungen für die durch den Ukrainekrieg von Ende Februar bis Ende Dezember 2022 (Begünstigungszeitraum) verursachten Mehrkosten bei Energie (Benzin, Dieselkraftstoff, Strom, Heizöl und Erdgas), Futtermitteln (Getreide und sonstige Futtermittel) und Hilfsstoffen (Sauerstoff) stellen, wenn diese erheblich sind (Bagatellgrenze 3.000 €!). Es handelt sich um ein Existenzsicherungsprogramm, weshalb vorwiegend Voll-, Haupt- und größere Zuerwerbsbetriebe gefördert werden können. Betriebe, die in diesem Zeitraum weniger als 3.000 € Mehrkosten hatten, erhalten leider keine entsprechende Ausgleichszahlung.
Möglich wurde diese Unterstützung durch eine Änderung der EMFF-Verordnung (EU) Nr. 508/2014 und einer Änderung des deutschen Operationellen Programms für den EMFF, die Mitte Dezember von der EU-Kommission genehmigt wurde. Um die Aquakulturbetriebe mit den noch verfügbaren EMFF-Mitteln unterstützen zu können, hat Bayern eine eigene Richtlinie erlassen, die heute in Kraft tritt: „Richtlinie zur Gewährung von Ausgleichszahlungen im Rahmen des Europäischen Meeres- und Fischereifonds an Aquakulturbetriebe zur Bewältigung der durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verursachten Mehrausgaben“ (https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2023-4/). Alle Unterlagen und detailliertere Informationen zur Antragstellung stehen im Förderwegweiser des StMELF unter „Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF 2014 – 2020)“: (https://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/094470/index.php) zur Verfügung. Die Anträge müssen spätestens bis zum 15. März 2023 bei der EMFF-Bewilligungsbehörde eingereicht werden (Ausschlussfrist).
Ob ein ähnliches Programm in anderen Bundesländern angeboten wird, muss beim zuständigen Ministerium erfragt werden.
Förderrichtlinie
Antragsformulare
Aquakulturbetriebe können einen Antrag auf Ausgleichszahlungen für die durch den Ukrainekrieg von Ende Februar bis Ende Dezember 2022 (Begünstigungszeitraum) verursachten Mehrkosten bei Energie (Benzin, Dieselkraftstoff, Strom, Heizöl und Erdgas), Futtermitteln (Getreide und sonstige Futtermittel) und Hilfsstoffen (Sauerstoff) stellen, wenn diese erheblich sind (Bagatellgrenze 3.000 €!). Es handelt sich um ein Existenzsicherungsprogramm, weshalb vorwiegend Voll-, Haupt- und größere Zuerwerbsbetriebe gefördert werden können. Betriebe, die in diesem Zeitraum weniger als 3.000 € Mehrkosten hatten, erhalten leider keine entsprechende Ausgleichszahlung.
Möglich wurde diese Unterstützung durch eine Änderung der EMFF-Verordnung (EU) Nr. 508/2014 und einer Änderung des deutschen Operationellen Programms für den EMFF, die Mitte Dezember von der EU-Kommission genehmigt wurde. Um die Aquakulturbetriebe mit den noch verfügbaren EMFF-Mitteln unterstützen zu können, hat Bayern eine eigene Richtlinie erlassen, die heute in Kraft tritt: „Richtlinie zur Gewährung von Ausgleichszahlungen im Rahmen des Europäischen Meeres- und Fischereifonds an Aquakulturbetriebe zur Bewältigung der durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verursachten Mehrausgaben“ (https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2023-4/). Alle Unterlagen und detailliertere Informationen zur Antragstellung stehen im Förderwegweiser des StMELF unter „Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF 2014 – 2020)“: (https://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/094470/index.php) zur Verfügung. Die Anträge müssen spätestens bis zum 15. März 2023 bei der EMFF-Bewilligungsbehörde eingereicht werden (Ausschlussfrist).
Ob ein ähnliches Programm in anderen Bundesländern angeboten wird, muss beim zuständigen Ministerium erfragt werden.
Förderrichtlinie
Antragsformulare
06.01.2023
“Münchner Merkur” und “Bild” berichten über die Streichung von Fisch aus dem Münchener KITA Speiseplan
Der VDBA initiiert und koordiniert Stellungnahmen, um falsche Argumentation des Stadtrats zu entkräften
In verschiedenen Artikeln des “Münchner Merkur” und der “BILD” wurde berichtet, dass in Zuge der Neuausschreibung der Münchener KITA Verpflegung Fisch vom Speiseplan genommen werden soll.
Münchener Merkur
BILD
Das Referat für Bildung in München und der Stadtrat argumentieren damit, dass Fisch Schwermetalle und Mikroplastik enthalte. Ebenso sei die Überfischung der Meere ein Grund für den zukünftigen Verzicht. Süßwasserfisch käme aufgrund der vorhandenen Gräten nicht in Betracht.
Sowohl das Fischinformationszentrum (FIZ) als auch das Bayerische Institut für Fischerei entkräften diese Argumente (s. beigefügte Downloads).
Fisch ist aufgrund des hohen Eiweißgehalts und den enthaltenen ungesättigten Fettsäuren ein wesentlicher Bestandteil der gesunden Ernährung. So empfiehlt die "Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.", dass Fisch ein-bis zweimal die Woche auf dem Speiseplan stehen soll.
Sowohl das Fischinformationszentrum als auch das Institut für Fischerei legen dar, dass eine Pauschalaussage zur Überfischung der Meere nicht getroffen werden kann. Bei vielen Beständen erfolgt eine nachhaltige Nutzung. Diese kann auch durch Labels wie dem Marine Stwardship Council (MSC) nachvollzogen werden. Ebenso kann nicht pauschal von einer Belastung der Fischerzeugnisse gesprochen werden. Hierbei ist sowohl die Fischart als auch Art und Ort der Erzeugung bzw. des Fangs zu betrachten. Insgesamt kann durch eine engmaschige Kontrolle der Fischprodukte eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden.
Die Argumentation, dass Süßwasserfisch mehr Gräten enthalte als Seefisch ist unzutreffend. Durch eine entsprechende Verarbeitung der Fische können praktisch grätenfreie Endprodukte erzeugt werden, ebenso wie bei Seefisch.
Insgesamt sollte natürlich auch bei der Gemeinschaftsverpflegung in KITAs darauf geachtet werden, dass regionale, nachhaltige Fische auf den Speiseplan kommen.
Bild: Quelle BILD online
Münchener Merkur
BILD
Das Referat für Bildung in München und der Stadtrat argumentieren damit, dass Fisch Schwermetalle und Mikroplastik enthalte. Ebenso sei die Überfischung der Meere ein Grund für den zukünftigen Verzicht. Süßwasserfisch käme aufgrund der vorhandenen Gräten nicht in Betracht.
Sowohl das Fischinformationszentrum (FIZ) als auch das Bayerische Institut für Fischerei entkräften diese Argumente (s. beigefügte Downloads).
Fisch ist aufgrund des hohen Eiweißgehalts und den enthaltenen ungesättigten Fettsäuren ein wesentlicher Bestandteil der gesunden Ernährung. So empfiehlt die "Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.", dass Fisch ein-bis zweimal die Woche auf dem Speiseplan stehen soll.
Sowohl das Fischinformationszentrum als auch das Institut für Fischerei legen dar, dass eine Pauschalaussage zur Überfischung der Meere nicht getroffen werden kann. Bei vielen Beständen erfolgt eine nachhaltige Nutzung. Diese kann auch durch Labels wie dem Marine Stwardship Council (MSC) nachvollzogen werden. Ebenso kann nicht pauschal von einer Belastung der Fischerzeugnisse gesprochen werden. Hierbei ist sowohl die Fischart als auch Art und Ort der Erzeugung bzw. des Fangs zu betrachten. Insgesamt kann durch eine engmaschige Kontrolle der Fischprodukte eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden.
Die Argumentation, dass Süßwasserfisch mehr Gräten enthalte als Seefisch ist unzutreffend. Durch eine entsprechende Verarbeitung der Fische können praktisch grätenfreie Endprodukte erzeugt werden, ebenso wie bei Seefisch.
Insgesamt sollte natürlich auch bei der Gemeinschaftsverpflegung in KITAs darauf geachtet werden, dass regionale, nachhaltige Fische auf den Speiseplan kommen.
Bild: Quelle BILD online
15.12.2022
Internationale Karpfenkonferenz in Ungarn 03.-05.05.2023
Von 03. bis 05. Mai 2023 findet in Szarvas die Internationale Karpfenkonferenz statt. Das Leitthema der Veranstaltung wird sein: "DEM KARPFEN DEN RICHTIGEN PLATZ IN DER AQUAKULTUR VERSCHAFFEN".
Als Vorträge werden u.a. angeboten
• Status und Trends in der Karpfenlieferkette in Asien: Experte von FFRC, China •
Karpfenkultur in Europa, Geschichte und aktuelle Trends: Herr Catalin Platon
• Karpfen in der globalen Aquakultur-Szene: Herr Bela Halasi-Kovacs
• Die Rolle der FAO bei der Entwicklung der Karpfenaquakultur: Herr Haydar Fersoy, FAO
Als Vorträge werden u.a. angeboten
• Status und Trends in der Karpfenlieferkette in Asien: Experte von FFRC, China •
Karpfenkultur in Europa, Geschichte und aktuelle Trends: Herr Catalin Platon
• Karpfen in der globalen Aquakultur-Szene: Herr Bela Halasi-Kovacs
• Die Rolle der FAO bei der Entwicklung der Karpfenaquakultur: Herr Haydar Fersoy, FAO
15.12.2022
Fortbildungstagung für Fischhaltung und Fischzucht in Pöcking am 17. und 18. Januar 2023
Auch 2023 findet die Fortbildungstagung der Fischzüchter der Landesanstalt für Landwirtschaft statt.
Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an die bayerischen Fischzüchter und Teichwirte und soll Neuerungen, Informationen und Fortschritte in der Aquakultur sowie zu den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vermitteln. Neben Fischzüchtern und Wissenschaftlern aus Bayern, anderen Bundesländern sowie dem benachbarten Ausland besuchen zahlreiche Vertreter der Fischereiverwaltung, der berufsständischen Vertretungen sowie Angehörige verschiedener Hochschulen die Tagung. In diesem Jahr werden aktuelle Entwicklungen zur Teichwirtschaft und Aquakultur und auch innovative Verfahren sowie die geänderten Rahmenbedingungen (Kostensituation, Klimawandel) thematisiert.
Link zur Veranstaltung: hier
Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an die bayerischen Fischzüchter und Teichwirte und soll Neuerungen, Informationen und Fortschritte in der Aquakultur sowie zu den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vermitteln. Neben Fischzüchtern und Wissenschaftlern aus Bayern, anderen Bundesländern sowie dem benachbarten Ausland besuchen zahlreiche Vertreter der Fischereiverwaltung, der berufsständischen Vertretungen sowie Angehörige verschiedener Hochschulen die Tagung. In diesem Jahr werden aktuelle Entwicklungen zur Teichwirtschaft und Aquakultur und auch innovative Verfahren sowie die geänderten Rahmenbedingungen (Kostensituation, Klimawandel) thematisiert.
Link zur Veranstaltung: hier
15.12.2022
Resolution des Deutschen Fischereiverbands zur Biodiversität in Binnengewässern
Derzeit werden auf verschiedenen politischen Ebenen Strategien für den Erhalt der aquatischen Biodiversität ausgearbeitet. Die Biodiversitätsstrategie 2030 der EU setzt Ziele zum Schutz der Natur. Alle Maßnahmen zusammen sollen mindestens 30 % der Landfläche abdecken. Wenn damit die Biodiversität und die Ökosystemleistungen der aquatischen Systeme gestärkt werden können, wäre das auch für die Fischbestände und deren Nutzungspotenzial vorteilhaft. Andererseits besteht seitens der Fischerei die Sorge, dass insbesondere eine pauschale und flächendeckende Unterschutzstellung erheblicher Anteile der bewirtschaftenden Gewässerflächen die wirtschaftenden Fischereibetriebe sowie die Angelfischerei nachhaltig treffen könnten, ohne zwangsläufig zu den Schutzzielen beizutragen.
Der Deutsche Fischereiverband zeigt in seiner Resolution auf wie die Umweltschutzziele im Bereich der Fischerei ausgestaltet werden müssen, um sowohl die Umweltziele zu erreichen als auch die dauerhafte Bewirtschaftung zu sichern.
Der Deutsche Fischereiverband zeigt in seiner Resolution auf wie die Umweltschutzziele im Bereich der Fischerei ausgestaltet werden müssen, um sowohl die Umweltziele zu erreichen als auch die dauerhafte Bewirtschaftung zu sichern.
29.09.2022
Mitgliederversammlung des VDBA
Prof. Werner Steffens zum Ehrenmitglied ernannt
Die ordentliche Mitgliederversammlung des VDBA fand am 24.08.2022 im Rahmen des Deutschen Fischereitags in Berlin statt. Die Spartenleitung, der Präsident und die Vizepräsidenten wurden im Zuge dessen neu gewählt. Die neuen und alten Vertreter der Fischerei auf Bundesebene sind.
Das Präsidium des VDBA bedankt sich bei den aus der Sparte Fluss- und Seenfischerei ausgeschieden Mitgliedern:
Dr. Peter Wißmath
Ulrich Paetsch
Prof. Werner Steffens
Und heißt gleichzeitig die neuen Mitglieder der Spartenleitung herzlich willkommen. Auf eine gute Zusammenarbeit.
Florian Lex
Martin Bork
Martin Boesenecker
Herr Professor Werner Steffens seine Frau sind der Einladung des Präsidiums auf persönliche Teilnahme an der Mitgliederversammlung gefolgt. Herr Prof. Steffens hatte im Vorfeld den Wunsch geäußert, seine Arbeit in der Spartenleitung Fluss- und Seenfischerei aus Altersgründen zu beenden. Das Präsidium hat diesen Wunsch zum Anlass genommen, das permanente Wirken von Prof. Steffens für die Einheit von Berufs- und Angelfischerei sowie seinen maßgeblichen Beitrag bei der Zusammenführung der Berufsfischer von Ost und West in den Jahren nach der Wende angemessen zu würdigen. Im Zuge dessen ernennt das Präsidium Herrn Prof. Steffens in der Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied des VDBA.
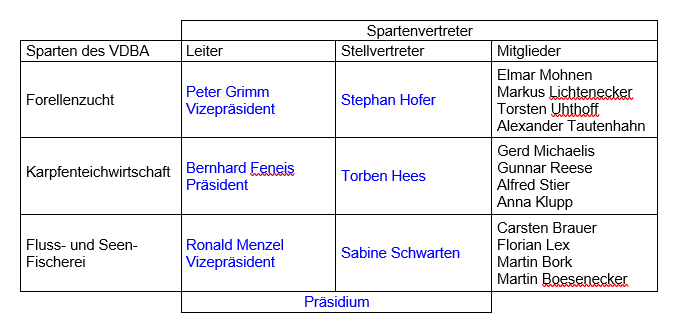
Das Präsidium des VDBA bedankt sich bei den aus der Sparte Fluss- und Seenfischerei ausgeschieden Mitgliedern:
Dr. Peter Wißmath
Ulrich Paetsch
Prof. Werner Steffens
Und heißt gleichzeitig die neuen Mitglieder der Spartenleitung herzlich willkommen. Auf eine gute Zusammenarbeit.
Florian Lex
Martin Bork
Martin Boesenecker
Herr Professor Werner Steffens seine Frau sind der Einladung des Präsidiums auf persönliche Teilnahme an der Mitgliederversammlung gefolgt. Herr Prof. Steffens hatte im Vorfeld den Wunsch geäußert, seine Arbeit in der Spartenleitung Fluss- und Seenfischerei aus Altersgründen zu beenden. Das Präsidium hat diesen Wunsch zum Anlass genommen, das permanente Wirken von Prof. Steffens für die Einheit von Berufs- und Angelfischerei sowie seinen maßgeblichen Beitrag bei der Zusammenführung der Berufsfischer von Ost und West in den Jahren nach der Wende angemessen zu würdigen. Im Zuge dessen ernennt das Präsidium Herrn Prof. Steffens in der Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied des VDBA.
Das Präsidium des VDBA bedankt sich bei den aus der Sparte Fluss- und Seenfischerei ausgeschieden Mitgliedern:
Dr. Peter Wißmath
Ulrich Paetsch
Prof. Werner Steffens
Und heißt gleichzeitig die neuen Mitglieder der Spartenleitung herzlich willkommen. Auf eine gute Zusammenarbeit.
Florian Lex
Martin Bork
Martin Boesenecker
Herr Professor Werner Steffens seine Frau sind der Einladung des Präsidiums auf persönliche Teilnahme an der Mitgliederversammlung gefolgt. Herr Prof. Steffens hatte im Vorfeld den Wunsch geäußert, seine Arbeit in der Spartenleitung Fluss- und Seenfischerei aus Altersgründen zu beenden. Das Präsidium hat diesen Wunsch zum Anlass genommen, das permanente Wirken von Prof. Steffens für die Einheit von Berufs- und Angelfischerei sowie seinen maßgeblichen Beitrag bei der Zusammenführung der Berufsfischer von Ost und West in den Jahren nach der Wende angemessen zu würdigen. Im Zuge dessen ernennt das Präsidium Herrn Prof. Steffens in der Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied des VDBA.
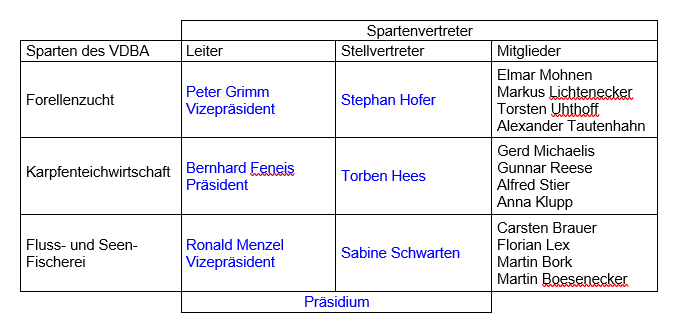
Das Präsidium des VDBA bedankt sich bei den aus der Sparte Fluss- und Seenfischerei ausgeschieden Mitgliedern:
Dr. Peter Wißmath
Ulrich Paetsch
Prof. Werner Steffens
Und heißt gleichzeitig die neuen Mitglieder der Spartenleitung herzlich willkommen. Auf eine gute Zusammenarbeit.
Florian Lex
Martin Bork
Martin Boesenecker
Herr Professor Werner Steffens seine Frau sind der Einladung des Präsidiums auf persönliche Teilnahme an der Mitgliederversammlung gefolgt. Herr Prof. Steffens hatte im Vorfeld den Wunsch geäußert, seine Arbeit in der Spartenleitung Fluss- und Seenfischerei aus Altersgründen zu beenden. Das Präsidium hat diesen Wunsch zum Anlass genommen, das permanente Wirken von Prof. Steffens für die Einheit von Berufs- und Angelfischerei sowie seinen maßgeblichen Beitrag bei der Zusammenführung der Berufsfischer von Ost und West in den Jahren nach der Wende angemessen zu würdigen. Im Zuge dessen ernennt das Präsidium Herrn Prof. Steffens in der Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied des VDBA.
29.09.2022
Neues System zur EU Taxonomie
Die EU Taxonomie legt fest inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als nachhaltig eingestuft werden. Diese Klassifizierung soll Anlagern orientierung geben und ein ressourcenschonenderes Wirtschaften fördern. Auch die Teichwirtschaft und Aquakultur werden davon erfasst. Hierzu ist der Bericht des AAC beigefügt.
Ein genereller Bericht über die Taxonomie ist ebenfalls als Download beigefügt (engl.).
Was ist die EU-Taxonomie?
Die Taxonomie ist ein EU-weit gültiges System zur Klassifizierung von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten. Sie soll Anlegerinnen und Anlegern Orientierung geben und Kapital für den grünen Umbau von Energieproduktion und Wirtschaft anreizen. Das Finanzsystem spielt eine Schlüsselrolle im Übergang zu einer emissionsarmen, ressourcenschonenden Wirtschaft. Die Europäische Kommission hat daher bereits im Juni 2021 erste Kriterien vorgelegt, die dazu beitragen sollen, in der Europäischen Union mehr Geld in nachhaltige, klimaschonende Tätigkeiten zu lenken und die Umweltbilanz in Unternehmensberichten sichtbarer zu machen.
Rechtlich bildet die EU-Taxonomie-Verordnung die Grundlage für die Nachhaltigkeitsklassifizierung. Sie stärkt die Markttransparenz für Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Sie etabliert ein Klassifikationssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten, um Anreize für Investoren und Investorinnen zu schaffen, die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu unterstützen.
Warum gibt es einen ergänzenden delegierten Rechtsakt zur EU-Taxonomie?
Der erste delegierte Rechtsakt legt weitgehend richtige, angemessene und strenge Maßstäbe an, um nachhaltige Tätigkeiten mit Beiträgen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung zu klassifizieren. Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministerium und des Bundesumweltministeriums hätte es eines ergänzenden delegierten Rechtsaktes mit Atomkraft und Erdgas nicht bedurft. Die EU-Kommission hatte sich aber bereits früh im Verfahren öffentlich festgelegt, in einem solchen ergänzenden delegierten Rechtsakt möglicherweise Atomenergie sowie Erdgas aufzunehmen. Diesen ergänzenden delegierten Rechtsakts hat die Europäische Kommission am 9. März 2022 erlassen.
Wie ist das weitere Verfahren zur EU-Taxonomie?
Im Europäischen Parlament hat es bei der Abstimmung am 6. Juli 2022 keine Mehrheit für einen Einwand gegen die Einstufung von Atomkraft und Erdgas als nachhaltig im Rahmen der EU-Taxonomie gegeben. Im Rat der Europäischen Union ist die erforderliche Mehrheit für einen Einwand gegen den delegierten Rechtsakt ebenfalls nicht gegeben, wobei die Bundesregierung dagegen gestimmt hat. Damit tritt der delegierte Rechtsakt nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Die EU hat konkrete Kriterien für klimafreundliche Investitionen festgelegt. In der Nacht zu Donnerstag wurde ein Rechtsakt angenommen, der Details der sogenannten Taxonomie regelt. Die EU-Staaten ließen um Mitternacht eine Frist verstreichen, um ihn abzulehnen. Darin werden etwa Kriterien für umweltfreundliche Bioenergie, Wasserkraft oder Forstwirtschaft festgelegt. Ob Gas und Atomkraft sowie bestimmte landwirtschaftliche Aktivitäten klimafreundlich sein können, wird allerdings noch nichts festgelegt. Dafür will die EU-Kommission bis Ende des Jahres einen weiteren Rechtsakt vorlegen.
Die Taxonomie ist umstritten, da sie Weichen für große Finanzströme stellt. Sie definiert, welche Bereiche der Wirtschaft klimafreundlich sind. Bürger und Investoren sollen so klare Informationen über nachhaltige Finanzprodukte erhalten - das soll dabei helfen, die für die Klimawende benötigten Milliarden zu mobilisieren.
Ein genereller Bericht über die Taxonomie ist ebenfalls als Download beigefügt (engl.).
Was ist die EU-Taxonomie?
Die Taxonomie ist ein EU-weit gültiges System zur Klassifizierung von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten. Sie soll Anlegerinnen und Anlegern Orientierung geben und Kapital für den grünen Umbau von Energieproduktion und Wirtschaft anreizen. Das Finanzsystem spielt eine Schlüsselrolle im Übergang zu einer emissionsarmen, ressourcenschonenden Wirtschaft. Die Europäische Kommission hat daher bereits im Juni 2021 erste Kriterien vorgelegt, die dazu beitragen sollen, in der Europäischen Union mehr Geld in nachhaltige, klimaschonende Tätigkeiten zu lenken und die Umweltbilanz in Unternehmensberichten sichtbarer zu machen.
Rechtlich bildet die EU-Taxonomie-Verordnung die Grundlage für die Nachhaltigkeitsklassifizierung. Sie stärkt die Markttransparenz für Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Sie etabliert ein Klassifikationssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten, um Anreize für Investoren und Investorinnen zu schaffen, die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu unterstützen.
Warum gibt es einen ergänzenden delegierten Rechtsakt zur EU-Taxonomie?
Der erste delegierte Rechtsakt legt weitgehend richtige, angemessene und strenge Maßstäbe an, um nachhaltige Tätigkeiten mit Beiträgen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung zu klassifizieren. Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministerium und des Bundesumweltministeriums hätte es eines ergänzenden delegierten Rechtsaktes mit Atomkraft und Erdgas nicht bedurft. Die EU-Kommission hatte sich aber bereits früh im Verfahren öffentlich festgelegt, in einem solchen ergänzenden delegierten Rechtsakt möglicherweise Atomenergie sowie Erdgas aufzunehmen. Diesen ergänzenden delegierten Rechtsakts hat die Europäische Kommission am 9. März 2022 erlassen.
Wie ist das weitere Verfahren zur EU-Taxonomie?
Im Europäischen Parlament hat es bei der Abstimmung am 6. Juli 2022 keine Mehrheit für einen Einwand gegen die Einstufung von Atomkraft und Erdgas als nachhaltig im Rahmen der EU-Taxonomie gegeben. Im Rat der Europäischen Union ist die erforderliche Mehrheit für einen Einwand gegen den delegierten Rechtsakt ebenfalls nicht gegeben, wobei die Bundesregierung dagegen gestimmt hat. Damit tritt der delegierte Rechtsakt nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Die EU hat konkrete Kriterien für klimafreundliche Investitionen festgelegt. In der Nacht zu Donnerstag wurde ein Rechtsakt angenommen, der Details der sogenannten Taxonomie regelt. Die EU-Staaten ließen um Mitternacht eine Frist verstreichen, um ihn abzulehnen. Darin werden etwa Kriterien für umweltfreundliche Bioenergie, Wasserkraft oder Forstwirtschaft festgelegt. Ob Gas und Atomkraft sowie bestimmte landwirtschaftliche Aktivitäten klimafreundlich sein können, wird allerdings noch nichts festgelegt. Dafür will die EU-Kommission bis Ende des Jahres einen weiteren Rechtsakt vorlegen.
Die Taxonomie ist umstritten, da sie Weichen für große Finanzströme stellt. Sie definiert, welche Bereiche der Wirtschaft klimafreundlich sind. Bürger und Investoren sollen so klare Informationen über nachhaltige Finanzprodukte erhalten - das soll dabei helfen, die für die Klimawende benötigten Milliarden zu mobilisieren.
29.09.2022
Fischkochbuch der FAO
Zum Jahr der Aquakultur gibt die FAO ein digitales Kochbuch heraus
Für das Jahr 2022 wurde von der FAO das Jahr der Aquakultur ausgerufen, in diesem Zuge wurde ein Kochbuch mit verschiedensten Rezepten und Fischarten herausgegeben. Vielleicht gibt es dieses Jahr an Weihnachten keinen Karpfen blau, sondern Mboto (Karpfen im Bananenblatt). Guten Appetit!
29.09.2022
Der Fischotter gefährdet ein Weltkulturerbe
Auch die überregionale Presse berichtet immer häufiger über den Fischotter
Die Süddeutsche Zeitung berichtet am 26.09.2022 über den Fischotter und die Gefahr, die dadurch für die heimische Teichwirtschaft besteht. Laut aktuellen Gutachten gibt es in Bayern inzwischen über 1.000 Fischotter, sodass von einem günstigen Erhaltungszustand gesprochen werden kann. Sogar Naturschutzverbände können sich inzwischen einen Abschuss in Einzelfällen vorstellen. Hoffen wir, dass dieser Sinneswandel noch rechtzeitg kommt.
Bild: Silas Stein, dpa
Den ganzen Artikel finden Sie hier
Bild: Silas Stein, dpa
Den ganzen Artikel finden Sie hier
17.08.2022
Fischerei-Hilfsprogramm: BMEL stockt maximale Hilfen für Fischereibetriebe auf Obergrenze wird auf 75.000 Euro angehoben
Neuanträge nicht erforderlich
Im Juli hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ein Kleinbeihilfeprogramm für Fischereibetriebe gestartet, die besonders unter Folgen des Ukraine-Kriegs leiden. Angesichts der andauernden Krisensituation wird das BMEL jetzt die maximal mögliche Hilfe pro Betrieb von 35.000 Euro auf 75.000 Euro deutlich anheben. Vor allem die gestiegenen Betriebskosten treffen die deutschen Fischerinnen und Fischer in Nord- und Ostsee weiterhin hart.
Die Erhöhung wurde erst möglich, nachdem die Europäische Kommission nach dem Start des BMEL-Hilfsprogramms eine Anpassung des Befristeten Krisenrahmens beschlossen hat. So sind in der Fischerei nun Beihilfen bis zu 75.000 Euro je Betrieb zulässig. Das BMEL schöpft damit den vollen Spielraum aus, den das EU-Recht für Fischerei-Kleinbeihilfen zulässt.
Die Kleinbeihilfe können Betriebe für Fischereifahrzeuge erhalten, die im Jahr 2021 in der Fischerei aktiv waren. Zusätzliche Voraussetzung ist, dass diese Fahrzeuge seit dem 24. Februar 2022 in der Fischerei aktiv sind oder noch in diesem Jahr aktiv werden.
Weitere Infos hier
Die Erhöhung wurde erst möglich, nachdem die Europäische Kommission nach dem Start des BMEL-Hilfsprogramms eine Anpassung des Befristeten Krisenrahmens beschlossen hat. So sind in der Fischerei nun Beihilfen bis zu 75.000 Euro je Betrieb zulässig. Das BMEL schöpft damit den vollen Spielraum aus, den das EU-Recht für Fischerei-Kleinbeihilfen zulässt.
Die Kleinbeihilfe können Betriebe für Fischereifahrzeuge erhalten, die im Jahr 2021 in der Fischerei aktiv waren. Zusätzliche Voraussetzung ist, dass diese Fahrzeuge seit dem 24. Februar 2022 in der Fischerei aktiv sind oder noch in diesem Jahr aktiv werden.
Weitere Infos hier
28.07.2022
Treibstoffhilfen auch für die Aquakulturbetreiber möglich
Für die Küsten und Meeresfischerei wurden Treibstoffhilfen, (Zuschüsse) eingerichtet. Auf Betreiben des VDBA ist es nun auch für die Aquakulturbetreiber möglich ähnliche Mittel zu bekommen. Im BMEL wurden dazu die Regelungen geändert, nun liegt es an den jeweiligen Bundesländern dies auch umzusetzen. Kritisch könnte sein, dass dort jeweils eine Kofinanzierung wie sie im EMFF gilt erforderlich ist. Die Mittel müssen von der Branche selbst im jeweiligen Länderministerium beantragt werden. Nur gestellte Anträge können zum Ziel führen.
28.07.2022
FAO Veranstaltung zur „Süßwasser Produktion“
Die FAO sieht die ländliche Teichwirtschaft geradezu als wegwegweisend für andere Gebiete, hinsichtlich Biodiversität, Sozioökonomie, und Nachhaltigkeit.
Zu der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) Veranstaltung in Vigo, Juli `22, wurde von den Gruppen „Süßwasser Produktion“ (VDBA) und „Muschelproduktion“ der FEAP eine Übersicht erarbeitet, welch besondere Bedeutung unserer Teichwirtschaft großräumig für die Regionen hat. Es geht um weit mehr als die Produktion gemessen in Tonnen, die Teichwirtschaft prägt Landschaften und viele Generationen der dort lebenden Bevölkerung. Dies konnten wir dort sehr deutlich machen, durch Vorträge und Redebeträge. Die Gesamtbedeutung unserer Teichwirtschaft wird mehr bei der FAO verstanden und wahrgenommen als in der EU Verwaltung.
Die FAO sieht die ländliche Teichwirtschaft geradezu als wegwegweisend für andere Gebiete, hinsichtlich Biodiversität, Sozioökonomie, und Nachhaltigkeit. Der VDBA betrachtet dies als Rückenstärkung in den Auseinandersetzungen mit den Brüsseler Behörden, wo viel mit diesen Begriffen argumentiert, aber häufig konträr gehandelt wird!
Die FAO sieht die ländliche Teichwirtschaft geradezu als wegwegweisend für andere Gebiete, hinsichtlich Biodiversität, Sozioökonomie, und Nachhaltigkeit. Der VDBA betrachtet dies als Rückenstärkung in den Auseinandersetzungen mit den Brüsseler Behörden, wo viel mit diesen Begriffen argumentiert, aber häufig konträr gehandelt wird!
28.07.2022
Schlussfolgerungen des Rates zu neuen strategischen Leitlinien für die Aquakultur in der EU
Im Rahmen der FEAP Freshwater Kommision wurde eine Übersicht über die Bedeutung der europäischen Teichwirtschaft unter der verschiedensten Aspekten erarbeitet. Federführend war diesmal der Kollege aus Tschechien. Diese Arbeit unterstütze die Diskussion die im Juli im Parlament in Brüssel stattfand.
Zitat:
Die Ministerinnen und Minister stellten ferner mit Besorgnis fest, dass die wachsenden Populationen von Prädatoren, insbesondere geschützter Arten wie Kormoran und Fischotter, für Aquakulturbetreiber in den letzten Jahren zu einem ernsthaften Problem geworden sind und viele Unternehmen ernsthaft geschädigt haben. Daher forderten sie die Kommission nachdrücklich auf, wirksame und effiziente EU-weite Bewirtschaftungsmaßnahmen zu ermitteln, um die durch Prädatoren verursachten Schäden zu verhindern oder zu mindern.
Zitat:
Die Ministerinnen und Minister stellten ferner mit Besorgnis fest, dass die wachsenden Populationen von Prädatoren, insbesondere geschützter Arten wie Kormoran und Fischotter, für Aquakulturbetreiber in den letzten Jahren zu einem ernsthaften Problem geworden sind und viele Unternehmen ernsthaft geschädigt haben. Daher forderten sie die Kommission nachdrücklich auf, wirksame und effiziente EU-weite Bewirtschaftungsmaßnahmen zu ermitteln, um die durch Prädatoren verursachten Schäden zu verhindern oder zu mindern.
09.07.2022
Notwendigkeit eines FEAP-Positionspapiers zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung über die Wiederherstellung der Natur
Die Europäische Kommission hat am 22. Juni 2022 einen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Wiederherstellung der Natur veröffentlicht. Ziel dieser Verordnung ist es, durch die Wiederherstellung von Ökosystemen zur kontinuierlichen, langfristigen und nachhaltigen Erholung der biologisch vielfältigen und widerstandsfähigen Natur in den Land- und Meeresgebieten der EU beizutragen und zur Verwirklichung der Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele der Union und zur Erfüllung ihrer internationalen Verpflichtungen beizutragen.
Diese Verordnung ist ein weiteres klares Beispiel dafür, wie sich der Green Deal negativ auf die Entwicklung der Aquakultur in der EU und im EWR auswirken kann, ohne eine positive Seite zu bieten. Unser Haupteinwand ist, dass es ein strategischer Fehler ist, keine spezifischen Verbindungen zwischen den Zielen der Naturwiederherstellung und der Nahrungsmittelproduktion in diesen Gebieten herzustellen.
Wir müssen jetzt den Verlauf dieses Dokuments ändern, wie es im Europäischen Parlament und im Rat diskutiert wird.
Bitte lesen Sie den Vorschlag der Europäischen Kommission und unseren Entwurf des Positionspapiers und teilen Sie uns Ihre Gedanken mit.
Diese Verordnung ist ein weiteres klares Beispiel dafür, wie sich der Green Deal negativ auf die Entwicklung der Aquakultur in der EU und im EWR auswirken kann, ohne eine positive Seite zu bieten. Unser Haupteinwand ist, dass es ein strategischer Fehler ist, keine spezifischen Verbindungen zwischen den Zielen der Naturwiederherstellung und der Nahrungsmittelproduktion in diesen Gebieten herzustellen.
Wir müssen jetzt den Verlauf dieses Dokuments ändern, wie es im Europäischen Parlament und im Rat diskutiert wird.
Bitte lesen Sie den Vorschlag der Europäischen Kommission und unseren Entwurf des Positionspapiers und teilen Sie uns Ihre Gedanken mit.
09.07.2022
YFM und Naturland: Vortrag über Biofischerzeugung
Nicole Klapstein und Jonathan Schleyken hielt für die YFM einen Vortrag über die Biofischerzeugung. Den interessierten Zuhörern wurden die Anforderungen und Potentiale des Biomarktes dargestellt. Bei einer spannenden Diskussionsrunde wurden noch offene Fragen geklärt.
Vielleicht inspiriert der Vortrag ja den ein oder anderen zum Umstieg auf Bio :)
Vielleicht inspiriert der Vortrag ja den ein oder anderen zum Umstieg auf Bio :)
09.07.2022
YFM in Königswartha
Dank der freundlichen Einladung von Dr. Gert Füllner konnten die Young Fishermen auf dem Fachtag Fischerei in Königswartha einen Vortrag halten.
Am 21. und 22. Juni 2022 wurde im Schloss Königswartha über verschiedenste Themen rund um die Fischzucht und Fischerei referiert:
Von aktuellen Neuerungen bezüglich der Förderungen, über Genetische Ressourcen von Zuchtsalmonidenstämmen und dem Stand der Zanderaquakultur,
Vermarktungsinnovationen rund um den Karpen bis hin zum neuen Animal Health Law und der Untersuchung der vertikalen Übertragung von KHV-I.
In Vertretung für die Young Fishermen hielt Lena Bächer am Dienstag einen Impulsvortrag „Young vs. Old Fishermen?!“. Dem bunt gemischten Publikum
stellte sie einige Aspekte der Zusammenarbeit von mehreren Generationen in einer Fischwirtschaft vor sowie Problempotenziale, die gerade bei einer
Übernahme in Erscheinung treten können. Das Resümee allerdings war klar, dass viel mehr „Young & Old Fishermen“ das Ziel sein sollte und kann.
Am 21. und 22. Juni 2022 wurde im Schloss Königswartha über verschiedenste Themen rund um die Fischzucht und Fischerei referiert:
Von aktuellen Neuerungen bezüglich der Förderungen, über Genetische Ressourcen von Zuchtsalmonidenstämmen und dem Stand der Zanderaquakultur,
Vermarktungsinnovationen rund um den Karpen bis hin zum neuen Animal Health Law und der Untersuchung der vertikalen Übertragung von KHV-I.
In Vertretung für die Young Fishermen hielt Lena Bächer am Dienstag einen Impulsvortrag „Young vs. Old Fishermen?!“. Dem bunt gemischten Publikum
stellte sie einige Aspekte der Zusammenarbeit von mehreren Generationen in einer Fischwirtschaft vor sowie Problempotenziale, die gerade bei einer
Übernahme in Erscheinung treten können. Das Resümee allerdings war klar, dass viel mehr „Young & Old Fishermen“ das Ziel sein sollte und kann.
08.07.2022
Informationsveranstaltung der EU-Kommission zum EMFAF
Am 7.Juli hat die Commission zu einem extra Info Meeting zum Thema EMFAF eingeladen. Online.
Dabei wurde eine Präsentation gezeigt, die zwar übersichtlich das Thema darstellt, aber nichts Neues zeigte.
Hauptaussage: was immer mit dem Geld der EU geschieht, ist fast aussschließlich auf den jeweiligen Nationalen Strategieplan zurückzuführen!
Die Frage wie die Hauptprobleme, ständig wachsende Bürokratie, sowie kontinuierliche Einschränkung der Verfügbarkeit von Wasser und Wasserflächen
der Commission gegenwärtig sind ,und wie sie mittels EMFAF dem Rechnung trägt, wurde so beantwortet:
dafür stehen keine Daten zur Verfügung, Die Frage wird an die Kommission weitergegeben.
Direkte Finanzielle Unterstützung ist in geringem Umfang (max 6%) möglich jedoch wendet kein MS dieses Instrument an.
Die Frage nach transnationalen Projekten wurde so konfus beantwortet, dass man daraus nichts ableiten kann.
Es wurde darauf hingewiesen: Es gibt auch ein Budget das direkt von der Commission verwaltet wird, dieses betrifft jedoch ausschließlich den Marinen Sektor.
Schlussfolgerung viel Wind um (fast) nicht Neues, nur dieses Mal von jemandem vorgetragen, den man bislang nicht kannte.
Eine Veranstaltung die unserer Vorbehalte gegenüber der Kommission bestätigt und um so mehr Arbeit am Nationalen Strategieplan erfordert durch das Gespräch mit den jeweils Verantwortlichen in den Bundesländern.
https://aac-europe.org/components/com_rseventspro/assets/images/files/EMFAF%20implementation%20-%20a%20guide%20to%20shared%20management.pdf
Dabei wurde eine Präsentation gezeigt, die zwar übersichtlich das Thema darstellt, aber nichts Neues zeigte.
Hauptaussage: was immer mit dem Geld der EU geschieht, ist fast aussschließlich auf den jeweiligen Nationalen Strategieplan zurückzuführen!
Die Frage wie die Hauptprobleme, ständig wachsende Bürokratie, sowie kontinuierliche Einschränkung der Verfügbarkeit von Wasser und Wasserflächen
der Commission gegenwärtig sind ,und wie sie mittels EMFAF dem Rechnung trägt, wurde so beantwortet:
dafür stehen keine Daten zur Verfügung, Die Frage wird an die Kommission weitergegeben.
Direkte Finanzielle Unterstützung ist in geringem Umfang (max 6%) möglich jedoch wendet kein MS dieses Instrument an.
Die Frage nach transnationalen Projekten wurde so konfus beantwortet, dass man daraus nichts ableiten kann.
Es wurde darauf hingewiesen: Es gibt auch ein Budget das direkt von der Commission verwaltet wird, dieses betrifft jedoch ausschließlich den Marinen Sektor.
Schlussfolgerung viel Wind um (fast) nicht Neues, nur dieses Mal von jemandem vorgetragen, den man bislang nicht kannte.
Eine Veranstaltung die unserer Vorbehalte gegenüber der Kommission bestätigt und um so mehr Arbeit am Nationalen Strategieplan erfordert durch das Gespräch mit den jeweils Verantwortlichen in den Bundesländern.
https://aac-europe.org/components/com_rseventspro/assets/images/files/EMFAF%20implementation%20-%20a%20guide%20to%20shared%20management.pdf
27.06.2022
Bayerische Teichbauempfehlungen novelliert
Die bayerischen Empfehlungen für den Teichbau sind überarbeitet und an neue Herausforderungen angepasst worden. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Umweltminister Thorsten Glauber haben jetzt die neue Fassung der „Empfehlungen für Bau und Betrieb von Fischteichen“ vorgestellt.
„Fischteiche sind ein wichtiger Bestandteil unserer bayerischen Landeskultur und prägen seit Jahrhunderten in vielen Regionen das Landschaftsbild. Bereits im Mittelalter wurden hier in Bayern Karpfen gehalten, seit vielen Jahrzehnten auch Forellen und weitere Nebenfische. Mit der Novellierung passen wir die Rahmenbedingungen an und schaffen damit die Basis für eine wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung. Nur so können wir die naturnahe Fischerzeugung in Bayern erhalten und weiter fördern“, sagte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.
Eine Expertengruppe aus beiden Ministerien, Vertretern der Fischerei, Wasserwirtschaft, Naturschutz, Landesanstalt für Landwirtschaft, Landesamt für Umwelt sowie weiterer Behörden haben über mehrere Jahre hinweg die Novellierung gemeinsam erarbeitet. Ab sofort können die Behörden, aber auch die Praktiker und viele Interessierte das neue Werk nutzen. Es gibt, wie bisher, einen praxisgerechten Rahmen vor und bietet den Teichwirten Hinweise innerhalb der geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen.
Die neuen Teichbauempfehlungen sind hier zu finden
„Fischteiche sind ein wichtiger Bestandteil unserer bayerischen Landeskultur und prägen seit Jahrhunderten in vielen Regionen das Landschaftsbild. Bereits im Mittelalter wurden hier in Bayern Karpfen gehalten, seit vielen Jahrzehnten auch Forellen und weitere Nebenfische. Mit der Novellierung passen wir die Rahmenbedingungen an und schaffen damit die Basis für eine wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung. Nur so können wir die naturnahe Fischerzeugung in Bayern erhalten und weiter fördern“, sagte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.
Eine Expertengruppe aus beiden Ministerien, Vertretern der Fischerei, Wasserwirtschaft, Naturschutz, Landesanstalt für Landwirtschaft, Landesamt für Umwelt sowie weiterer Behörden haben über mehrere Jahre hinweg die Novellierung gemeinsam erarbeitet. Ab sofort können die Behörden, aber auch die Praktiker und viele Interessierte das neue Werk nutzen. Es gibt, wie bisher, einen praxisgerechten Rahmen vor und bietet den Teichwirten Hinweise innerhalb der geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen.
Die neuen Teichbauempfehlungen sind hier zu finden
23.05.2022
Teichwirtschaft Thema in Brüssel
Als Reaktion zum Austausch vom 01.02.2022 hat der EU Umweltkomissar Virginijus Sinkevi?ius in einem Brief geantwortet. Die traditionelle Teichwirtschaft genießt auch auf EU-Ebene hohes Ansehen. Entsprechend soll diese Bewirtschaftsform in Zukunft erhalten und gefördert werden. Das Schreiben finden Sie als Download beigefügt.
Hier zeigt sich, dass die enge Zusammenarbeit von Verbänden, wie dem VDBA, Politik, Praktikern und Verwaltung der Teichwirtschaft Gehör verschaffen kann.
Über das Treffen zwischen den Praktikern, Verbandsvertretern, EU Parlamentsabgeordneten und den Vertretern der Kommission haben wir berichtet: Biodiversitäts-Strategie der EU (vdba.org)
Hier zeigt sich, dass die enge Zusammenarbeit von Verbänden, wie dem VDBA, Politik, Praktikern und Verwaltung der Teichwirtschaft Gehör verschaffen kann.
Über das Treffen zwischen den Praktikern, Verbandsvertretern, EU Parlamentsabgeordneten und den Vertretern der Kommission haben wir berichtet: Biodiversitäts-Strategie der EU (vdba.org)
22.05.2022
Teichwirte und Fischzüchtertagung im Waldviertel
Bei der Teichwirte und Fischzüchtertagung im Waldviertel wurde die enge zusammen Arbeit zwischen Deutschl. Und Österreich auf Verbandsebenebetont. Was häufig die Arbeit ergänzt und auch erleichtert.
Als weiteren Beitrag des VDBA wurden die Young Fishermen vorgestellt. Das Engagemant der jungen Truppe wurde mit großem Interesse wahrgenommen.
Weitere Interessante Beiträge waren u.a.
Als weiteren Beitrag des VDBA wurden die Young Fishermen vorgestellt. Das Engagemant der jungen Truppe wurde mit großem Interesse wahrgenommen.
Weitere Interessante Beiträge waren u.a.
- Ein Projekt zur Herstellung von Fischmehl aus Hauseigenen Schlachtabfällen
- Praxisbeispielen die großen Unterschiede innerhalb der EU gezeigt: wie man mit Prädatoren (Otter) um geht, (in CZ gibt es das Thema nicht) wie man neue Teiche genehmigt bekommt, in CZ muss man sie einfach nur bauen. Jeder neue Teich ist willkommen und es wird ein Neubau nur unterstützt und nichts in den Weg gelegt.
- ! obwohl das AHL auch in Österreich noch nicht gilt, werden Maßnahmen aus der alten, noch offiziell geltenden Gesetzeslage nicht um gesetzt, wenn sie in der Neuen Version hinfällig sind ( KHV Teichdesinfektion z.B. was in Bayern immer noch umgesetzt wird! )
23.04.2022
Standpunkt des BUND zur Gesamtsituation des Europäischen Aals im Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen – Stellungnahme des DAFV
Am 04. April 2022 hat der BUND ein neues Standpunktpapier mit dem Titel: „Gefährdet und gejagt: Warum ein Fangverbot für den Europäischen Aal jetzt notwendig ist“[1] veröffentlicht. Trotz überwiegend gut recherchierter Hintergrundinformationen zur Gesamtsituation werden Quellen fehlgedeutet und falsche Schlüsse gezogen.
06.04.2022
Die Produktionskosten für Fisch(erzeugnisse) steigen weiter an
Finanzhilfen, um die Folgen des Ukrainekriegs für Fischerzeuger/innen abzumildern
Die Folgen des Ukrainekriegs sind auch für Fischerzeuger/innen spürbar. Die Kosten für Futter- und Betriebsmittel steigen stetig an. Die Ukraine und auch Russalnd sind sowohl Lieferanten für Getreide als auch für Düngemittel und Energie. Durch Sanktionen auf seitens der EU und Russlands ist der Import wichtiger Güter erschwert bis unmöglich.
Auf EU-Ebene gibt es Bestrebungen Mittel aus dem EMFAF zur Verfügung zu stellen, um betroffenen Betrieben zu helfen. Aktuell gibt es unglücklicherweise noch keine Umsetzungsstrategie für Deutschland.
Auf EU-Ebene gibt es Bestrebungen Mittel aus dem EMFAF zur Verfügung zu stellen, um betroffenen Betrieben zu helfen. Aktuell gibt es unglücklicherweise noch keine Umsetzungsstrategie für Deutschland.
08.03.2022
Anfrage private Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine
Der VDBA verurteilt den von Russlands Staatspräsidenten Putin getriebenen Angriffskrieg gegen die Ukraine aufs Schärfste – Anfrage über unbürokratische Aufnahme
Der von Putin befohlene Angriff Russlands auf die Ukraine erschüttert uns zutiefst. Unsere Gedanken sind bei den Menschen, in deren Heimat sich Schreckliches ereignet.
Seitens des Ukrainischen Landwirtschaftsministeriums und des Ukrainischen Fischereiverbands kamen bereits Anfragen, ob eine unbürokratische Aufnahme von Geflüchteten aus ukrainischen Fischwirtschaftsgebieten durch Kollegen aus Deutschland möglich sei. Der VDBA bittet seine Mitglieder zu überlegen, ob eine Aufnahme möglich ist. Uns ist bewusst, dass dies eine erhebliche private Herausforderung ist und dass es sicherlich nicht in jeden Fall möglich sein wird. Falls Sie und Ihre Familien sich entscheiden einer Fischerfamilie vorübergehend Obdach zu bieten, so wenden Sie sich bitte an info@vdba.org
Der von Putin befohlene Angriff Russlands auf die Ukraine erschüttert uns zutiefst. Unsere Gedanken sind bei den Menschen, in deren Heimat sich Schreckliches ereignet.
Seitens des Ukrainischen Landwirtschaftsministeriums und des Ukrainischen Fischereiverbands kamen bereits Anfragen, ob eine unbürokratische Aufnahme von Geflüchteten aus ukrainischen Fischwirtschaftsgebieten durch Kollegen aus Deutschland möglich sei. Der VDBA bittet seine Mitglieder zu überlegen, ob eine Aufnahme möglich ist. Uns ist bewusst, dass dies eine erhebliche private Herausforderung ist und dass es sicherlich nicht in jeden Fall möglich sein wird. Falls Sie und Ihre Familien sich entscheiden einer Fischerfamilie vorübergehend Obdach zu bieten, so wenden Sie sich bitte an info@vdba.org
08.03.2022
Copa Coegca Zur russischen Invasion in der Ukraine und ihre Auswirkungen auf die EU-Landwirtschaft,
Die gesamte europäische Landwirtschaft betrachtet die Entwicklung des Konflikts in der Ukraine mit großer Sorge. Auf den Treffen von Copa und Cogeca Vorstandssitzungen in der vergangenen Woche brachten alle Mitglieder ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk zum Ausdruck, wobei unsere besonderen Gedanken in diesen schwierigen Zeiten bei unseren Landwirten, Teichwirten und Kollegen der Agrargenossenschaften sind. Unsere Solidarität erschöpft sich nicht in Worten, Copa und Cogeca werden in den kommenden Tagen und Wochen je nach der Entwicklung des Konflikts konkrete Maßnahmen ergreifen.
In Kriegszeiten ist die Ernährungssicherheit von entscheidender Bedeutung, und es ist wichtig, frühzeitig die notwendigen Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die am stärksten betroffenen Menschen in der Ukraine und auf der ganzen Welt weiterhin mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Dies ist der Moment, um die vereinte europäische und internationale Zusammenarbeit weiter zu stärken.
Die Destabilisierung der Ukraine durch die russische Invasion hat bereits erhebliche globale Folgen ausgelöst. Die Russen und Ukrainer sind wichtige internationale Agrarexporteure. Die Ukraine ist der viertgrößte externe Lebensmittellieferant der EU und beliefert die EU mit einem Viertel ihrer Getreide- und Pflanzenölimporte, einschließlich fast der Hälfte ihres Maisbedarfs.
Während also die Frage der Energieversorgung heute in aller Munde ist, ist die Landwirtschaft von ebenso großer strategischer Bedeutung. Für die Landwirte in der EU, die während der Pandemie eine Schlüsselrolle gespielt und ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt haben, kommt diese Krise zu der Covid-Krise und dem drastischen Preisanstieg bei allen wichtigen landwirtschaftlichen Betriebsmitteln (d. h. Energie, Futtermittel, Düngemittel) in den letzten Monaten hinzu.
Um ein starkes und friedliches Europa zu erhalten, ist die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und der Lieferketten von grundlegender Bedeutung. Dies ist eine Lektion, die wir von den Gründervätern Europas gelernt haben. In den kommenden Tagen und Wochen müssen sich die EU-Entscheidungsträger zwar in erster Linie auf die laufende Konfliktlösung konzentrieren, aber auch deren Auswirkungen auf wichtige Wirtschaftssektoren berücksichtigen. Die europäische Landwirtschaft ist ein zentraler Pfeiler unserer strategischen Autonomie. Die EU-Entscheidungsträger müssen entschlossen und schnell handeln, um sie zu erhalten.
In Kriegszeiten ist die Ernährungssicherheit von entscheidender Bedeutung, und es ist wichtig, frühzeitig die notwendigen Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die am stärksten betroffenen Menschen in der Ukraine und auf der ganzen Welt weiterhin mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Dies ist der Moment, um die vereinte europäische und internationale Zusammenarbeit weiter zu stärken.
Die Destabilisierung der Ukraine durch die russische Invasion hat bereits erhebliche globale Folgen ausgelöst. Die Russen und Ukrainer sind wichtige internationale Agrarexporteure. Die Ukraine ist der viertgrößte externe Lebensmittellieferant der EU und beliefert die EU mit einem Viertel ihrer Getreide- und Pflanzenölimporte, einschließlich fast der Hälfte ihres Maisbedarfs.
Während also die Frage der Energieversorgung heute in aller Munde ist, ist die Landwirtschaft von ebenso großer strategischer Bedeutung. Für die Landwirte in der EU, die während der Pandemie eine Schlüsselrolle gespielt und ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt haben, kommt diese Krise zu der Covid-Krise und dem drastischen Preisanstieg bei allen wichtigen landwirtschaftlichen Betriebsmitteln (d. h. Energie, Futtermittel, Düngemittel) in den letzten Monaten hinzu.
Um ein starkes und friedliches Europa zu erhalten, ist die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und der Lieferketten von grundlegender Bedeutung. Dies ist eine Lektion, die wir von den Gründervätern Europas gelernt haben. In den kommenden Tagen und Wochen müssen sich die EU-Entscheidungsträger zwar in erster Linie auf die laufende Konfliktlösung konzentrieren, aber auch deren Auswirkungen auf wichtige Wirtschaftssektoren berücksichtigen. Die europäische Landwirtschaft ist ein zentraler Pfeiler unserer strategischen Autonomie. Die EU-Entscheidungsträger müssen entschlossen und schnell handeln, um sie zu erhalten.
08.03.2022
Kosten für Betriebsmittel steigen sprunghaft an
Ukraine-Krieg: Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Die Auswirkungen der Invasion, die der russische Staatspräsident Wladimir Putin begonnen hat, werden die Welt dauerhaft verändern. Auch in der europäischen Agrarpolitik werden sie Spuren hinterlassen, denn die Bedeutung von Nahrungssicherheit wird deutlicher.
Wie die Agrarmärkte aktuell reagieren und was noch zu erwarten ist wird im beigefügten Artiekl erläutert.
Wie die Agrarmärkte aktuell reagieren und was noch zu erwarten ist wird im beigefügten Artiekl erläutert.
08.03.2022
Staatliche Beihilfen: Kommission bittet um Stellungnahmen zur vorgeschlagenen Überarbeitung der EU-Beihilfevorschriften für die Land- und Forstwirtsch
Die Europäische Kommission ruft alle Interessenträger auf, zu den vorgeschlagenen überarbeiteten Vorschriften für staatliche Beihilfen im Agrar-, Forst- und Fischereisektor Stellung zu nehmen. Mit der vorgeschlagenen Überarbeitung sollen die derzeitigen Vorschriften an die aktuellen strategischen Prioritäten der EU angepasst werden, insbesondere an die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) und den europäischen Grünen Deal. Die Mitgliedstaaten und andere Interessenträger können bis zum 13. März 2022 an der Konsultation teilnehmen.
Weitere Infos
Weitere Infos
22.02.2022
Ausgleichszahlungen für Schäden durch Kormorane und andere Prädatoren
für die durch in der Fischerei und in Aquakulturen entstehenden Schäden beispielsweise. durch Kormorane, Fischotter oder Kegelrobben (sogenannte Prädatoren) kann Deutschland künftig höhere Ausgleichszahlungen leisten. Die EU-Kommission hat zugestimmt, dass für diese Schäden bis Ende 2026 eine Beihilfe in Höhe von reichlich 35 Millionen Euro gewährt werden kann.. Bislang belief sich der Umfang der möglichen Beihilfe auf 7 Millionen Euro.
Soweit in den einzelnen Bundesländern vorgesehen, sind nachweisbare Ertragsausfälle aufgrund der vollständigen oder teilweisen Vernichtung der Aquakulturproduktion und der entsprechenden Produktionsmittel bzw. nachweisbare Ertragsausfälle in der Fischerei sowie Sachschäden an Vermögenswerten der Fischerei und der Aquakultur, insbesondere an Anlagen der Aquakultur, Gewässern, Dämmen, Vorflutern und Fanggeräten beihilfefähig.
Auf Grundlage der "Rahmenrichtlinie für den Ausgleich von durch geschützte Tiere verursachten Schäden in der Fischerei und Aquakulturkönnen" können die Bundesländer bei Bedarf in eigener Zuständigkeit Ausgleichsleistungen zeitnah gewähren. Die Bundesländer entscheiden nach eigenem Ermessen über den Zeitpunkt und die Notwendigkeit der landesrechtlichen Anwendung der Rahmenrichtlinie Prädatoren. Ansprechpartner für die potenziellen Begünstigten sind daher die Länder.
Soweit in den einzelnen Bundesländern vorgesehen, sind nachweisbare Ertragsausfälle aufgrund der vollständigen oder teilweisen Vernichtung der Aquakulturproduktion und der entsprechenden Produktionsmittel bzw. nachweisbare Ertragsausfälle in der Fischerei sowie Sachschäden an Vermögenswerten der Fischerei und der Aquakultur, insbesondere an Anlagen der Aquakultur, Gewässern, Dämmen, Vorflutern und Fanggeräten beihilfefähig.
Auf Grundlage der "Rahmenrichtlinie für den Ausgleich von durch geschützte Tiere verursachten Schäden in der Fischerei und Aquakulturkönnen" können die Bundesländer bei Bedarf in eigener Zuständigkeit Ausgleichsleistungen zeitnah gewähren. Die Bundesländer entscheiden nach eigenem Ermessen über den Zeitpunkt und die Notwendigkeit der landesrechtlichen Anwendung der Rahmenrichtlinie Prädatoren. Ansprechpartner für die potenziellen Begünstigten sind daher die Länder.
21.02.2022
Biodiversitäts-Strategie der EU
Fischerei-Vertreter aus Verwaltung, Verbänden und Praxis das Gespräch mit der Kabinettschefin Frau Preising
Die geplante EU-Biodiversitäts-Strategie fordert den Schutz von 30% der Land- und Meeresfläche der EU-Staaten. 10% der Fläche sollen sogar streng geschützt werden und der menschliche Einfluss und die Nutzung dort unterbleiben.
Die Teichwirte und Berufsfischer befürchten, dass dabei die traditionellen, nachhaltigen Nutzungen in Teichgebieten, Flüssen und Seen erheblich beeinträchtigt werden. Schon jetzt sind diese Regionen oft NATURA 2000-Gebiete.
Um den Generaldirektion Umwelt die Besonderheiten der bayerischen Teichwirtschaft und Berufsfischerei zu vermitteln, suchten Fischerei-Vertreter aus Verwaltung (Dr, Reiter, Dr. Oberle), Verbänden (VDBA-Präsident Feneis) und Praxis (Hans Klupp) das Gespräch mit der Kabinettschefin Frau Preising. In der sehr konstruktiven Diskussion stellten die Bayern die Biodiversität der Teichgebiete und Wasserlandschaften dar und erklärten, dass nur eine Fortführung der traditionellen Nutzungsformen die herausragende Arten- und Habitatvielfalt bewahren kann.
Die Kabinettschefin der DG Umwelt hörte interessiert zu, unterstützte die Fortführung traditioneller Nutzung und versicherte diese Zusammenhänge in der weiteren Diskussion zu berücksichtigen.
Die Teichwirte und Berufsfischer befürchten, dass dabei die traditionellen, nachhaltigen Nutzungen in Teichgebieten, Flüssen und Seen erheblich beeinträchtigt werden. Schon jetzt sind diese Regionen oft NATURA 2000-Gebiete.
Um den Generaldirektion Umwelt die Besonderheiten der bayerischen Teichwirtschaft und Berufsfischerei zu vermitteln, suchten Fischerei-Vertreter aus Verwaltung (Dr, Reiter, Dr. Oberle), Verbänden (VDBA-Präsident Feneis) und Praxis (Hans Klupp) das Gespräch mit der Kabinettschefin Frau Preising. In der sehr konstruktiven Diskussion stellten die Bayern die Biodiversität der Teichgebiete und Wasserlandschaften dar und erklärten, dass nur eine Fortführung der traditionellen Nutzungsformen die herausragende Arten- und Habitatvielfalt bewahren kann.
Die Kabinettschefin der DG Umwelt hörte interessiert zu, unterstützte die Fortführung traditioneller Nutzung und versicherte diese Zusammenhänge in der weiteren Diskussion zu berücksichtigen.
02.02.2022
Vorträge der Fortbildungstagung des Instituts für Fischerei
Am 19.01.2022 fand die Fortbildungstagung des Instituts für Fischerei online statt. Es wurden viele interessante Themen vorgestellt. Folgende Vorträge sind hier online verfügbar
Begrüßung und Tätigkeitsbericht
Aktuelles aus der Fischereifachverwaltung
Aktuelles aus der Fischereirechtsverwaltung
Erste Ergebnisse bei der Aufzucht von Forellenbrut in einer Kaltwasser-(Teil)Kreislaufanlage
Flavobakterien und Forellen – Erkenntnisse aus dem Bakteriosen-Projekt
Klimawandel: Welchen Beitrag leistet das Fischfutter
Erfahrungen mit der Verwendung von Insekten als Futtermittel für Forellen und andere Fischarten
Deutschlands Aquakultur im Vergleich zur Situation und den Perspektiven in Europa
Begrüßung und Tätigkeitsbericht
Aktuelles aus der Fischereifachverwaltung
Aktuelles aus der Fischereirechtsverwaltung
Erste Ergebnisse bei der Aufzucht von Forellenbrut in einer Kaltwasser-(Teil)Kreislaufanlage
Flavobakterien und Forellen – Erkenntnisse aus dem Bakteriosen-Projekt
Klimawandel: Welchen Beitrag leistet das Fischfutter
Erfahrungen mit der Verwendung von Insekten als Futtermittel für Forellen und andere Fischarten
Deutschlands Aquakultur im Vergleich zur Situation und den Perspektiven in Europa
14.01.2022
Fortbildungstagung für Fischhaltung und Fischzucht am 19. Januar 2022
Die alljährlich stattfindende Fortbildungsveranstaltung richtet sich an Teichwirte und Betreiber von Aquakulturanlagen. Das Programm besteht aus Beiträgen zu aktuellen Neuerungen aus der Fischereiverwaltung, zur Entwicklung der Aquakultur in Deutschland sowie zu neuen Ergebnissen aus der anwendungsorientierten Forschung. In Fachvorträgen werden neue Möglichkeiten für die Aquakultur in Bayern mit praktischen Aspekten der Teichwirtschaft, Fischfütterung sowie zu Fischkrankheiten präsentiert.
Organisation und Hinweise zur TagungAufgrund der aktuellen Situation wird die Januartagung vom Institut für Fischerei online über die Plattform Cisco Webex durchgeführt.
Anmeldungen sind bis 16.01.2022 möglich.
Anmeldung: LfL/IFI-Januartagung "Fischhaltung und Fischzucht",
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie zwei Tage vor der Veranstaltung eine E-Mail mit dem Zugangslink.
Es wird empfohlen, sich etwa 10 Minuten vor Beginn der Tagung einzuwählen.
Programm
(9:00 - 16:00 Uhr)
Eröffnung
Stephan Sedlmayer, Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Freising
Begrüßung und Tätigkeitsbericht
Dr. H. Wedekind, LfL / Institut für Fischerei, Starnberg
Aktuelles aus der Fischereiverwaltung
Dr. R. Reiter, Dr. B. Darsow, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München
Umsetzung des neuen Tierseuchenrechts (AHL) im Bereich der Aquakultur
Dr. M. Ruhs, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, München
50 Jahre VBB - was hat uns das gebracht?
A. Deß und H. Siller, Verband Bayerischer Berufsfischer e. V., Nürnberg
Deutschlands Aquakultur im Vergleich zur Situation und den Perspektiven in Europa
Dr. U. Brämick, Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow, Potsdam
Perspektiven und Herausforderungen für die Aquakultur - Nationaler Strategieplan Aquakultur Deutschland, NASTAQ 2021 - 2030
Th. Schiller und U. Weniger, Sächsisches Staatsministerium f. Energie, Klimaschutz, Umwelt u. Landwirtschaft
Mittagspause (12.00 – 13.00 Uhr)
Erste Ergebnisse bei der Aufzucht von Forellenbrut in einer Kaltwasser-(Teil)Kreislaufanlage
G. Schmidt, LfL / Institut für Fischerei, Starnberg
Flavobakterien und Forellen – Erkenntnisse aus dem Bakteriosen-Projekt
Dr. P. Steinbauer, Tiergesundheitsdienst Bayern, Abteilung Fischgesundheitsdienst, Poing
Einfluss organischer Düngung auf Fischertrag, Wasser- und Bodenqualität in Karpfenteichen
PhD J. Másilko, LfL / Institut für Fischerei, Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft, Höchstadt
Klimawandel: Welchen Beitrag leistet das Fischfutter?
E. Schneeberger, Garant-Tiernahrung, Pöchlarn/Österreich
Regionale Erzeugung von Insekten (Fliegenmaden, Hermetia illuscens) zur Verwendung in der Tierernährung
W. Westermeier, Farminsect, Bergkirchen
Erfahrungen mit der Verwendung von Insekten als Futtermittel für Forellen und andere Fischarten
Dr. H. Wedekind, LfL / Institut für Fischerei,
StarnbergVeranstaltung FELSOnline-Versammlung des „Fördervereins der Ehemaligen der Landesanstalt e. V.“ (FELS)
18.00 – 19.30 Uhr (gleiche Zugangsdaten; ausschließlich für Mitglieder)
Quelle: Institut für Fischerei
Organisation und Hinweise zur TagungAufgrund der aktuellen Situation wird die Januartagung vom Institut für Fischerei online über die Plattform Cisco Webex durchgeführt.
Anmeldungen sind bis 16.01.2022 möglich.
Anmeldung: LfL/IFI-Januartagung "Fischhaltung und Fischzucht",
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie zwei Tage vor der Veranstaltung eine E-Mail mit dem Zugangslink.
Es wird empfohlen, sich etwa 10 Minuten vor Beginn der Tagung einzuwählen.
Programm
(9:00 - 16:00 Uhr)
Eröffnung
Stephan Sedlmayer, Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Freising
Begrüßung und Tätigkeitsbericht
Dr. H. Wedekind, LfL / Institut für Fischerei, Starnberg
Aktuelles aus der Fischereiverwaltung
Dr. R. Reiter, Dr. B. Darsow, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München
Umsetzung des neuen Tierseuchenrechts (AHL) im Bereich der Aquakultur
Dr. M. Ruhs, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, München
50 Jahre VBB - was hat uns das gebracht?
A. Deß und H. Siller, Verband Bayerischer Berufsfischer e. V., Nürnberg
Deutschlands Aquakultur im Vergleich zur Situation und den Perspektiven in Europa
Dr. U. Brämick, Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow, Potsdam
Perspektiven und Herausforderungen für die Aquakultur - Nationaler Strategieplan Aquakultur Deutschland, NASTAQ 2021 - 2030
Th. Schiller und U. Weniger, Sächsisches Staatsministerium f. Energie, Klimaschutz, Umwelt u. Landwirtschaft
Mittagspause (12.00 – 13.00 Uhr)
Erste Ergebnisse bei der Aufzucht von Forellenbrut in einer Kaltwasser-(Teil)Kreislaufanlage
G. Schmidt, LfL / Institut für Fischerei, Starnberg
Flavobakterien und Forellen – Erkenntnisse aus dem Bakteriosen-Projekt
Dr. P. Steinbauer, Tiergesundheitsdienst Bayern, Abteilung Fischgesundheitsdienst, Poing
Einfluss organischer Düngung auf Fischertrag, Wasser- und Bodenqualität in Karpfenteichen
PhD J. Másilko, LfL / Institut für Fischerei, Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft, Höchstadt
Klimawandel: Welchen Beitrag leistet das Fischfutter?
E. Schneeberger, Garant-Tiernahrung, Pöchlarn/Österreich
Regionale Erzeugung von Insekten (Fliegenmaden, Hermetia illuscens) zur Verwendung in der Tierernährung
W. Westermeier, Farminsect, Bergkirchen
Erfahrungen mit der Verwendung von Insekten als Futtermittel für Forellen und andere Fischarten
Dr. H. Wedekind, LfL / Institut für Fischerei,
StarnbergVeranstaltung FELSOnline-Versammlung des „Fördervereins der Ehemaligen der Landesanstalt e. V.“ (FELS)
18.00 – 19.30 Uhr (gleiche Zugangsdaten; ausschließlich für Mitglieder)
Quelle: Institut für Fischerei
14.01.2022
Öffentliche Konsultation der EU-Kommission zur Überarbeitung der EU-Beihilfevorschriften für die Fischerei, Land- und Forstwirtschaft
Gleich zu Jahresbeginn hat die EU-Kommission mit heutigem Tag eine öffentliche Konsultation zu den überarbeiteten Vorschriften für staatliche Beihilfen im Agrar-, Forst- und Fischereisektor gestartet. Siehe hierzu nachfolgenden Link:
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/uberarbeitung-der-eu-beihilfevorschriften-fur-fischerei-land-und-forstwirtschaft-kommission-bittet-2022-01-11_de
Durch die Überarbeitung der Beihilferegelungen sollen notwendige Anpassungen an den „Green Deal“ in Kombination mit der Gemeinsamen Agrar-Politik der EU (GAP) erfolgen.
Im Rahmen der Konsultation können Mitgliedstaaten und andere Interessenträger bis zum 13.03.2022 eine Stellungnahme bei der EU-Kommission einreichen.
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/uberarbeitung-der-eu-beihilfevorschriften-fur-fischerei-land-und-forstwirtschaft-kommission-bittet-2022-01-11_de
Durch die Überarbeitung der Beihilferegelungen sollen notwendige Anpassungen an den „Green Deal“ in Kombination mit der Gemeinsamen Agrar-Politik der EU (GAP) erfolgen.
Im Rahmen der Konsultation können Mitgliedstaaten und andere Interessenträger bis zum 13.03.2022 eine Stellungnahme bei der EU-Kommission einreichen.
14.01.2022
Dramatischer Ausbruch von Geflügelpest in Israel
Im Hulatal, einem Hauptplatz für die Rast bei Vogelzug führte die Vogelgrippe H5N1 bislang zu mehr als 5000 toten Kranichen. Rückkehrende Zugvögel wie Schelladler, Wespenbussard, etc., stellen eine Gefahr für unsere heimische Vogelwelt, vornehmlich auch in den Teichgebieten, dar. Beim Handling mit toten Vögeln besteht auch die Ansteckungsgefahr für den Menschen. Tote Vögel, und Risse daher entsprechend geschützt handhaben! Das FLI spricht vom stärksten Ausbruch in Europa
Neue Impfleitlinie für Fische zum Jahreswechsel veröffentlicht. Grundlagen, Techniken und verfügbare Stoffe werden beschrieben. Die gut beschriebene Situation bei den jeweiligen Krankheiten und Fischen, hebt aber auch die sehr geringe tatsächliche Möglichkeit Fische durch Impfung zu schützen mangels Impfstoff-Angebot hervor.
Bild: msn.com
Neue Impfleitlinie für Fische zum Jahreswechsel veröffentlicht. Grundlagen, Techniken und verfügbare Stoffe werden beschrieben. Die gut beschriebene Situation bei den jeweiligen Krankheiten und Fischen, hebt aber auch die sehr geringe tatsächliche Möglichkeit Fische durch Impfung zu schützen mangels Impfstoff-Angebot hervor.
Bild: msn.com
15.12.2021
Dreimonatiges Aalfangverbot wird 2022 fortgesetzt
Wie am 14. Dezember 2021 bekannt wurde, haben sich die Fischereiminister der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auf die Fortsetzung des 3-monatigen Aal-Fangverbots geeinigt. Die Forderung des Internationalen Rats für Meeresforschung (ICES), jeglichen Aalfang europaweit einzustellen, wurde nicht umgesetzt.
Die Einigung gewährleist eine Fortführung der europäischen Strategie zum Schutz des Europäischen Aals inklusive der nationalen Aal-Managementpläne. In den nationalen Aalmanagementplänen sind die Maßnahmen zur Wiederauffüllung des Bestands des Europäischen Aals in Übereinstimmung mit der EU-Aalverordnung (Verordnung (EG) Nr. 1100/2007) definiert. Diese Maßnahmen umfassen in Deutschland auch den Besatz mit Jungaalen, der ohne Glasaalfischerei nicht möglich wäre.
Gleichzeitig wird durch die Entscheidung sichergestellt, dass illegale Fänge und Exporte von Glasaalen nach Asien durch die Aufrechterhaltung eines legalen Marktes effektiv gehemmt werden. Es wurde befürchtet, dass die negativen Effekte eines Fangverbots überwiegen würden. Im Falle eines Fangverbots bestände die akute Gefahr, dass durch die Abwesenheit der Freizeit- und Berufsfischerei, Wilderei und illegale Exporte nach Asien den legalen Markt ersetzen und sehr viel schlimmere Folgen hätten, als ein verantwortungsvoll agierender und gut kontrollierter Markt in Übereinstimmung mit der EU-Aalverordnung.
Position des Ostseebeirats – Baltic Sea Advisory Council (BSAC)
Zur Einbindung der verschiedenen Interessengruppen (Stakeholder) im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) wurden von der Europäischen Kommission regionale Beiräte eingeführt. Für die Angelfischerei in Deutschland ist dabei der Ostseebeirat (Baltic Sea Advisory Council = BSAC) von zentraler Bedeutung. In Bezug auf das vom ICES geforderte Aalfangverbot konnte der BSAC bisher keine gemeinsame Position finden. Allerdings haben sich die BSAC-Mitglieder unter Mitwirkung des DAFV auf gemeinsame Positionen bezüglich illegaler Aalfang und Exportverbot, Gewässerverbauung und andere menschliche Einflüsse sowie die Notwendigkeit einer besseren Datenerhebung, geeinigt.
Wie geht es weiter?
Die Europäische Kommission wird im Jahr 2022 eine umfassende Konsultation mit den Interessengruppen einleiten. Ziel ist die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts zur weiteren Verringerung der Aal-Sterblichkeit.
Quelle: Dreimonatiges Aalfangverbot wird 2022 fortgesetzt - Deutscher Angelfischerverband e.V. (dafv.de)
Die Einigung gewährleist eine Fortführung der europäischen Strategie zum Schutz des Europäischen Aals inklusive der nationalen Aal-Managementpläne. In den nationalen Aalmanagementplänen sind die Maßnahmen zur Wiederauffüllung des Bestands des Europäischen Aals in Übereinstimmung mit der EU-Aalverordnung (Verordnung (EG) Nr. 1100/2007) definiert. Diese Maßnahmen umfassen in Deutschland auch den Besatz mit Jungaalen, der ohne Glasaalfischerei nicht möglich wäre.
Gleichzeitig wird durch die Entscheidung sichergestellt, dass illegale Fänge und Exporte von Glasaalen nach Asien durch die Aufrechterhaltung eines legalen Marktes effektiv gehemmt werden. Es wurde befürchtet, dass die negativen Effekte eines Fangverbots überwiegen würden. Im Falle eines Fangverbots bestände die akute Gefahr, dass durch die Abwesenheit der Freizeit- und Berufsfischerei, Wilderei und illegale Exporte nach Asien den legalen Markt ersetzen und sehr viel schlimmere Folgen hätten, als ein verantwortungsvoll agierender und gut kontrollierter Markt in Übereinstimmung mit der EU-Aalverordnung.
Position des Ostseebeirats – Baltic Sea Advisory Council (BSAC)
Zur Einbindung der verschiedenen Interessengruppen (Stakeholder) im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) wurden von der Europäischen Kommission regionale Beiräte eingeführt. Für die Angelfischerei in Deutschland ist dabei der Ostseebeirat (Baltic Sea Advisory Council = BSAC) von zentraler Bedeutung. In Bezug auf das vom ICES geforderte Aalfangverbot konnte der BSAC bisher keine gemeinsame Position finden. Allerdings haben sich die BSAC-Mitglieder unter Mitwirkung des DAFV auf gemeinsame Positionen bezüglich illegaler Aalfang und Exportverbot, Gewässerverbauung und andere menschliche Einflüsse sowie die Notwendigkeit einer besseren Datenerhebung, geeinigt.
Wie geht es weiter?
Die Europäische Kommission wird im Jahr 2022 eine umfassende Konsultation mit den Interessengruppen einleiten. Ziel ist die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts zur weiteren Verringerung der Aal-Sterblichkeit.
Quelle: Dreimonatiges Aalfangverbot wird 2022 fortgesetzt - Deutscher Angelfischerverband e.V. (dafv.de)
07.12.2021
Weil es nicht egal ist, wo der Fisch herkommt.
Fisch zu Weihnachten? Ja, bitte!
Fisch zu Weihnachten? Ja, bitte!
Obwohl mittlerweile von verschiedener Seite her suggeriert wird, dass Fischkonsum per se falsch und umweltschädlich ist, können wir euch beruhigen: „Guter“ Fisch gehört sich auf den Teller, für eine gesunde Ernährung ein- bis zweimal die Woche (1). Was ist denn jetzt „gut“? Laut Greenpeace zum Beispiel Karpfen aus extensiver Teichwirtschaft. (2)
Der Weihnachtskarpfen ist also gesichert! Lieber nicht? Warum man mit den alten Vorurteilen längst aufräumen kann und ihr auf jeden Fall zum Klassiker greifen solltet, erklären wir euch gerne.
Weil es nicht egal ist, wo der Fisch herkommt.
Regional = Verantwortungsvolle Fischzucht
Ein*e Fischzüchter*in hat vor allem ein Ziel: den Tieren soll es so gut gehen, wie nur irgend möglich. Die gute fachliche Praxis der extensiven Karpfenzucht erfüllt dies aus sich selbst heraus. Im natürlichen Lebensraum Teich hat ein Satzkarpfen 20 m³ Platz, um sein arttypisches Verhalten auszuleben: schwimmend Naturnahrung fangen und im Teichboden nach Kleinstlebewesen gründeln. Eine Zufütterung findet, wenn dann, mit Körnerfrüchten, wie Getreide oder Hülsenfrüchten, aus regionaler Landwirtschaft statt.
Die Fische brauchen nicht mit Antibiotika behandelt werden und das Ende Ihres Lebens bekommen sie nicht einmal mit, da die elektrische Betäubung im Wasserbecken so schnell geht.
Alle Kenntnisse und Fähigkeiten, um den Fischen ein Maximum an Tierwohl zu garantieren, sind Teil der Ausbildung. Nur mit dieser ist man berechtigt, Fische auch zum Speisefisch zu verarbeiten. Kontrollen auf strengem Niveau garantieren gesunde Fische in hoher Qualität und ein hygienisch einwandfreies Produkt.

Regional = Erhalt der Kulturlandschaft
Süßwasser wird in Deutschland nicht nur in Flüssen und Seen gespeichert, sondern auch in den Teichen, die für die Fischzucht angelegt wurden. Dies ist aber mitunter schon vor 1000 Jahren geschehen (3), sodass die Teiche vielmehr an natürliche Gewässer erinnern. Damit ist deren Bedeutung als Standort für unzählige Pflanzenarten sowie Habitat für Amphibien, Reptilien, Insekten (und deren Larven), Vögeln und Säugetieren sehr hoch. Laubfrösche beispielsweise profitieren von der Nutzung des Gewässers als strukturreicher Karpfenteich. „Eine (extensive) Bewirtschaftung ist den Zielen des Naturschutzes generell dienlich“. Aber nicht nur der einzelne Teich spielt eine Rolle, sondern die Kulturlandschaft als Ganzes. Mit der Vielzahl vernetzter Teiche haben (mobile) Tierarten die Möglichkeit, das für sie optimale Gewässer als Lebensraum zu wählen (4). Daher ist gerade die Aufteilung großer Fischwirtschaftsgebiete durch viele kleine Teichwirte bedeutsam. Das traditionell weitergegebene Wissen zur extensiven Bewirtschaftung der artenreichen Teiche wurde 2021 durch die Auszeichnung als UNESCO Immaterielles Kulturerbe geehrt (in Bayern; 5).
Die größte Ehrung sollte allerdings der Karpfen selbst erhalten. Durch seine gründelnde Tätigkeit erhält er die stofflichen Vorgänge, auf die das Ökosystem „Stehendes Binnengewässer“ basiert. Ohne Karpfen verlanden Teiche und sind dann kein wertvolles aquatisches Habitat mehr. Daher ist der aktive Schutz von Karpfen gleichzeitig Artenschutz für den ganzen Lebensraum.

Fischhof Bächer
Regional = Niedriger CO2-Footprint
Nachdem die Biodiversität durch Karpfenteichwirtschaft gestärkt wird, wird auch unser
Klima geschont. Auch wenn es sowieso in aller Munde ist, und man zum Teil auch gezwungen wird, seinen Konsum zu überdenken; beim Fisch ist es doch am einfachsten.
Karpfen, Forellen, Zander und Co. von regionalen Fischzüchtern werden genau so weit transportiert, wie ihr vom Fischladen entfernt wohnt. Das können vielleicht einmal 50 km sein, mit Sicherheit aber weniger als beim Thunfisch aus dem Pazifik oder Pangasius aus vietnamesischer Intensivzucht. Regional eingekaufter Fisch fördert kleine Betriebe und deren Leistungen für unsere Kulturlandschaft - und man weiß, wo der Fisch herkommt.
Regional = Gut für Dich
Am Schluss geht’s halt doch um die Wurst .. äh, den Fisch: Wenn ich halt einfach ein Seefisch-Fan bin und mich dessen Nährwerte überzeugen, was will ich dann mit Karpfen?
Ganz beruhigt genießen! Eine Portion (ca. 200 g) Karpfenfilet pro Woche versorgt uns bereits mit den benötigten Mengen an ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Außerdem hat man bereits 2/3 des täglichen Eiweißbedarfs gedeckt, und das mit hochwertigen Aminosäuren. Wirkstoffe wie Phosphor, Selen, Vitamin E und C unterstützen unser Immunsystem (6). Schwermetalle sind außerdem kein Thema.
Karpfen wird seit einigen Jahrzehnten filetiert, enthäutet und grätengeschnitten angeboten. Damit hat man ein einfach zu verarbeitendes Fischfilet, das weder den Kindern noch den empfindlichen Menschen im Hals stecken bleibt. Der Fettgehalt wird durch artgerechte Fütterung unter 10 % gehalten, kontrolliert durch staatliche Beratungsstellen.
Auch um den modrigen Beigeschmack muss man sich keine Gedanken mehr machen: Die Fische werden nach der Abfischung erst einige Zeit im sauberen Wasser „gehältert“. In dieser Zeit scheiden sie die natürlichen Moderstoffe aus. Dadurch bleibt nur der dezent nussige, sehr feine Eigengeschmack übrig. Ein Gedicht!
Neugierig geworden? Dann frage einfach beim Fischzüchter in deiner Nähe nach,
für Genuss mit gutem Gewissen.

Young Fishermen (Lena Bächer), Dezember 2021

Weihnachtskarpfen modern: Filet mit Bratmandeln
Für 4 Personen (Rezeptquelle: Ursula Knutzen. Vereinfacht durch Lena Bächer)
Obwohl mittlerweile von verschiedener Seite her suggeriert wird, dass Fischkonsum per se falsch und umweltschädlich ist, können wir euch beruhigen: „Guter“ Fisch gehört sich auf den Teller, für eine gesunde Ernährung ein- bis zweimal die Woche (1). Was ist denn jetzt „gut“? Laut Greenpeace zum Beispiel Karpfen aus extensiver Teichwirtschaft. (2)
Der Weihnachtskarpfen ist also gesichert! Lieber nicht? Warum man mit den alten Vorurteilen längst aufräumen kann und ihr auf jeden Fall zum Klassiker greifen solltet, erklären wir euch gerne.
Weil es nicht egal ist, wo der Fisch herkommt.
Regional = Verantwortungsvolle Fischzucht
Ein*e Fischzüchter*in hat vor allem ein Ziel: den Tieren soll es so gut gehen, wie nur irgend möglich. Die gute fachliche Praxis der extensiven Karpfenzucht erfüllt dies aus sich selbst heraus. Im natürlichen Lebensraum Teich hat ein Satzkarpfen 20 m³ Platz, um sein arttypisches Verhalten auszuleben: schwimmend Naturnahrung fangen und im Teichboden nach Kleinstlebewesen gründeln. Eine Zufütterung findet, wenn dann, mit Körnerfrüchten, wie Getreide oder Hülsenfrüchten, aus regionaler Landwirtschaft statt.
Die Fische brauchen nicht mit Antibiotika behandelt werden und das Ende Ihres Lebens bekommen sie nicht einmal mit, da die elektrische Betäubung im Wasserbecken so schnell geht.
Alle Kenntnisse und Fähigkeiten, um den Fischen ein Maximum an Tierwohl zu garantieren, sind Teil der Ausbildung. Nur mit dieser ist man berechtigt, Fische auch zum Speisefisch zu verarbeiten. Kontrollen auf strengem Niveau garantieren gesunde Fische in hoher Qualität und ein hygienisch einwandfreies Produkt.

Regional = Erhalt der Kulturlandschaft
Süßwasser wird in Deutschland nicht nur in Flüssen und Seen gespeichert, sondern auch in den Teichen, die für die Fischzucht angelegt wurden. Dies ist aber mitunter schon vor 1000 Jahren geschehen (3), sodass die Teiche vielmehr an natürliche Gewässer erinnern. Damit ist deren Bedeutung als Standort für unzählige Pflanzenarten sowie Habitat für Amphibien, Reptilien, Insekten (und deren Larven), Vögeln und Säugetieren sehr hoch. Laubfrösche beispielsweise profitieren von der Nutzung des Gewässers als strukturreicher Karpfenteich. „Eine (extensive) Bewirtschaftung ist den Zielen des Naturschutzes generell dienlich“. Aber nicht nur der einzelne Teich spielt eine Rolle, sondern die Kulturlandschaft als Ganzes. Mit der Vielzahl vernetzter Teiche haben (mobile) Tierarten die Möglichkeit, das für sie optimale Gewässer als Lebensraum zu wählen (4). Daher ist gerade die Aufteilung großer Fischwirtschaftsgebiete durch viele kleine Teichwirte bedeutsam. Das traditionell weitergegebene Wissen zur extensiven Bewirtschaftung der artenreichen Teiche wurde 2021 durch die Auszeichnung als UNESCO Immaterielles Kulturerbe geehrt (in Bayern; 5).
Die größte Ehrung sollte allerdings der Karpfen selbst erhalten. Durch seine gründelnde Tätigkeit erhält er die stofflichen Vorgänge, auf die das Ökosystem „Stehendes Binnengewässer“ basiert. Ohne Karpfen verlanden Teiche und sind dann kein wertvolles aquatisches Habitat mehr. Daher ist der aktive Schutz von Karpfen gleichzeitig Artenschutz für den ganzen Lebensraum.

Fischhof Bächer
Regional = Niedriger CO2-Footprint
Nachdem die Biodiversität durch Karpfenteichwirtschaft gestärkt wird, wird auch unser
Klima geschont. Auch wenn es sowieso in aller Munde ist, und man zum Teil auch gezwungen wird, seinen Konsum zu überdenken; beim Fisch ist es doch am einfachsten.
Karpfen, Forellen, Zander und Co. von regionalen Fischzüchtern werden genau so weit transportiert, wie ihr vom Fischladen entfernt wohnt. Das können vielleicht einmal 50 km sein, mit Sicherheit aber weniger als beim Thunfisch aus dem Pazifik oder Pangasius aus vietnamesischer Intensivzucht. Regional eingekaufter Fisch fördert kleine Betriebe und deren Leistungen für unsere Kulturlandschaft - und man weiß, wo der Fisch herkommt.
Regional = Gut für Dich
Am Schluss geht’s halt doch um die Wurst .. äh, den Fisch: Wenn ich halt einfach ein Seefisch-Fan bin und mich dessen Nährwerte überzeugen, was will ich dann mit Karpfen?
Ganz beruhigt genießen! Eine Portion (ca. 200 g) Karpfenfilet pro Woche versorgt uns bereits mit den benötigten Mengen an ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Außerdem hat man bereits 2/3 des täglichen Eiweißbedarfs gedeckt, und das mit hochwertigen Aminosäuren. Wirkstoffe wie Phosphor, Selen, Vitamin E und C unterstützen unser Immunsystem (6). Schwermetalle sind außerdem kein Thema.
Karpfen wird seit einigen Jahrzehnten filetiert, enthäutet und grätengeschnitten angeboten. Damit hat man ein einfach zu verarbeitendes Fischfilet, das weder den Kindern noch den empfindlichen Menschen im Hals stecken bleibt. Der Fettgehalt wird durch artgerechte Fütterung unter 10 % gehalten, kontrolliert durch staatliche Beratungsstellen.
Auch um den modrigen Beigeschmack muss man sich keine Gedanken mehr machen: Die Fische werden nach der Abfischung erst einige Zeit im sauberen Wasser „gehältert“. In dieser Zeit scheiden sie die natürlichen Moderstoffe aus. Dadurch bleibt nur der dezent nussige, sehr feine Eigengeschmack übrig. Ein Gedicht!
Neugierig geworden? Dann frage einfach beim Fischzüchter in deiner Nähe nach,
für Genuss mit gutem Gewissen.

Young Fishermen (Lena Bächer), Dezember 2021

Weihnachtskarpfen modern: Filet mit Bratmandeln
Für 4 Personen (Rezeptquelle: Ursula Knutzen. Vereinfacht durch Lena Bächer)
Ca. 800 g Karpfenfilet grätengeschnitten salzen und pfeffern. Danach in Mehl wenden, sodass sie vollständig bedeckt sind.
2 Knoblauchzehen pressen oder fein hacken, 1 Bund Petersilie hacken. ½ kleine Zitrone auspressen. Ca. 100 g Mandelblättchen vorbereiten.
Filet mit der eingeschnittenen Seite in das vorgeheizte (!) Fett in eine Pfanne geben. Gut verwenden kann man Butterschmalz oder Sonnenblumenöl. Olivenöl ist nicht geeignet.
Nach ca. 4 Minuten (bei dicken Filets etwas länger) wenden. Auf der anderen Seite genauso lange fertig braten. Könnte die Mehlkruste zu schwarz werden, Fett nachgeben bzw. die Hitze leicht regulieren.
Während das Filet brät, die Mandelblättchen in Butterschmalz mit dem feingehackten Knoblauch goldbraun braten. Rühren nicht vergessen! Feingehackte Petersilie, Salz, Pfeffer, etwas braunen Zucker und zum Schluss einen Spritzer Zitronensaft dazugeben.
Als Beilage passen beispielsweise Kartoffelpüree, Spitzkohlgemüse mit Karotte, gemischter Salat.
Guten Appetit und ein frohes Weihnachtsfest!
Fischhof Bächer
Fisch ist immer gesund : Zwei Mal pro Woche darf er ruhig auf dem Speiseplan stehen - Rhein-Neckar-Zeitung Regionalnachrichten - RNZ
Einkaufsratgeber Fisch, Greenpeace, 2016
Heimat der Rekorde : Das älteste Fischzuchtgebiet Europas (br.de)
Ber-Bayer-Akad-f-Natursch-u-Landschaftspfl_28_0129-0141.pdf (zobodat.at)
Bundesweites Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe | Deutsche UNESCO-Kommission
Köstliche Karpfen. ARGE Fisch, 2010.
2 Knoblauchzehen pressen oder fein hacken, 1 Bund Petersilie hacken. ½ kleine Zitrone auspressen. Ca. 100 g Mandelblättchen vorbereiten.
Filet mit der eingeschnittenen Seite in das vorgeheizte (!) Fett in eine Pfanne geben. Gut verwenden kann man Butterschmalz oder Sonnenblumenöl. Olivenöl ist nicht geeignet.
Nach ca. 4 Minuten (bei dicken Filets etwas länger) wenden. Auf der anderen Seite genauso lange fertig braten. Könnte die Mehlkruste zu schwarz werden, Fett nachgeben bzw. die Hitze leicht regulieren.
Während das Filet brät, die Mandelblättchen in Butterschmalz mit dem feingehackten Knoblauch goldbraun braten. Rühren nicht vergessen! Feingehackte Petersilie, Salz, Pfeffer, etwas braunen Zucker und zum Schluss einen Spritzer Zitronensaft dazugeben.
Als Beilage passen beispielsweise Kartoffelpüree, Spitzkohlgemüse mit Karotte, gemischter Salat.
Guten Appetit und ein frohes Weihnachtsfest!
Fischhof Bächer
Fisch ist immer gesund : Zwei Mal pro Woche darf er ruhig auf dem Speiseplan stehen - Rhein-Neckar-Zeitung Regionalnachrichten - RNZ
Einkaufsratgeber Fisch, Greenpeace, 2016
Heimat der Rekorde : Das älteste Fischzuchtgebiet Europas (br.de)
Ber-Bayer-Akad-f-Natursch-u-Landschaftspfl_28_0129-0141.pdf (zobodat.at)
Bundesweites Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe | Deutsche UNESCO-Kommission
Köstliche Karpfen. ARGE Fisch, 2010.
26.11.2021
Auszug aus dem Koalitionsvertrag zum Thema Fischerei
Kommentar des VDBA Präsidenten Bernhard Feneis
Ich sehe das so ,dass wir garnicht in den Köpfen der künftigen Politik vorkommen. Einerseit sind wir nicht wichtig genug dass man sich damit befasst, andererseits sind jetzt auch keine direkten Einschränkungen zu erwarten. Kann man ja auch als Chance sehen. - B. Feneis
Auszug aus dem Koalitionsvertrag:
Meeresschutz
Intakte Meere sind maßgeblich für Klimaschutz und Biodiversität. Schutz, Sicherheit und nachhaltige Nutzung der Ozeane wollen wir miteinander in Einklang bringen. Wir starten eine Meeresoffensive zum Schutz der Meeresnatur, erarbeiten eine kohärente und verbindliche Meeresstrategie, richten eine Meereskoordination unter Leitung eines Meeresbeauftragten ein und etablieren eine Nationale Meereskonferenz. Wir wollen die Ökosystemleistungen von Nord- und Ostsee erhalten. Dafür werden wir die Schutzgebiete in der deutschen Außenwirtschaftszone (AWZ) effektiv managen, und die dafür notwendigen personellen und infrastrukturellen Ressourcen zur Verfügung stellen. 10 Prozent der AWZ werden wir gemäß der EU-Biodiversitätsstrategie streng schützen und dort Zonen frei von schädlicher Nutzung ausweisen. Wir setzen uns für den zügigen Abschluss eines VN-Abkommens zum Schutz der Biodiversität auf Hoher See, für ein international verbindliches Rahmenwerk gegen die Vermüllung der Meere und für die Einrichtung von internationalen Schutzgebieten, insbesondere dem Weddellmeer, ein. Wir setzen uns für ein Verbot von Scheuerfäden (sogenannten Dolly Ropes) auf europäischer Ebene ein. Für die Bergung und Vernichtung von Munitionsaltlasten in der Nord- und Ostsee wird ein Sofortprogramm aufgelegt sowie ein Bund-Länderfonds für die mittel- und langfristige Bergung eingerichtet und solide finanziert. Wir setzen uns international für strenge Umweltstandards und die verbindliche Überprüfung der Umweltverträglichkeit im Tiefseebergbau ein und werden die Meeresforschung fortführen, um das Wissen über die Tiefsee auszuweiten. Wir wollen keine neuen Genehmigungen für Öl- und Gasbohrungen jenseits der erteilten Rahmenbetriebserlaubnisse für die deutsche Nord- und Ostsee erteilen.
Fischerei
Wir setzen uns für den Erhalt der Fischerei an unseren Küsten ein. Wir werden auf europäischer und internationaler Ebene eine faire, wissenschaftsbasierte Ermittlung und Zuteilung der Fangquoten einfordern. Dazu werden wir eine "Zukunftskommission Fischerei" initiieren, um Empfehlungen für eine nachhaltige Fischerei und Aquakultur, Binnen- und Hochseefischerei zu erarbeiten. Wir wollen die Grundschleppnetz-Fischerei beschränken und Fangtechniken artenspezifisch anpassen sowie eine naturschutzgerechte Regulierung von Stellnetzen. Wir erkennen die Leistung der Anglerinnen und Angler für den Natur- und Artenschutz an.
Auszug aus dem Koalitionsvertrag:
Meeresschutz
Intakte Meere sind maßgeblich für Klimaschutz und Biodiversität. Schutz, Sicherheit und nachhaltige Nutzung der Ozeane wollen wir miteinander in Einklang bringen. Wir starten eine Meeresoffensive zum Schutz der Meeresnatur, erarbeiten eine kohärente und verbindliche Meeresstrategie, richten eine Meereskoordination unter Leitung eines Meeresbeauftragten ein und etablieren eine Nationale Meereskonferenz. Wir wollen die Ökosystemleistungen von Nord- und Ostsee erhalten. Dafür werden wir die Schutzgebiete in der deutschen Außenwirtschaftszone (AWZ) effektiv managen, und die dafür notwendigen personellen und infrastrukturellen Ressourcen zur Verfügung stellen. 10 Prozent der AWZ werden wir gemäß der EU-Biodiversitätsstrategie streng schützen und dort Zonen frei von schädlicher Nutzung ausweisen. Wir setzen uns für den zügigen Abschluss eines VN-Abkommens zum Schutz der Biodiversität auf Hoher See, für ein international verbindliches Rahmenwerk gegen die Vermüllung der Meere und für die Einrichtung von internationalen Schutzgebieten, insbesondere dem Weddellmeer, ein. Wir setzen uns für ein Verbot von Scheuerfäden (sogenannten Dolly Ropes) auf europäischer Ebene ein. Für die Bergung und Vernichtung von Munitionsaltlasten in der Nord- und Ostsee wird ein Sofortprogramm aufgelegt sowie ein Bund-Länderfonds für die mittel- und langfristige Bergung eingerichtet und solide finanziert. Wir setzen uns international für strenge Umweltstandards und die verbindliche Überprüfung der Umweltverträglichkeit im Tiefseebergbau ein und werden die Meeresforschung fortführen, um das Wissen über die Tiefsee auszuweiten. Wir wollen keine neuen Genehmigungen für Öl- und Gasbohrungen jenseits der erteilten Rahmenbetriebserlaubnisse für die deutsche Nord- und Ostsee erteilen.
Fischerei
Wir setzen uns für den Erhalt der Fischerei an unseren Küsten ein. Wir werden auf europäischer und internationaler Ebene eine faire, wissenschaftsbasierte Ermittlung und Zuteilung der Fangquoten einfordern. Dazu werden wir eine "Zukunftskommission Fischerei" initiieren, um Empfehlungen für eine nachhaltige Fischerei und Aquakultur, Binnen- und Hochseefischerei zu erarbeiten. Wir wollen die Grundschleppnetz-Fischerei beschränken und Fangtechniken artenspezifisch anpassen sowie eine naturschutzgerechte Regulierung von Stellnetzen. Wir erkennen die Leistung der Anglerinnen und Angler für den Natur- und Artenschutz an.
26.11.2021
Mitgliederrundschreiben zum ICES advice zum Aal
Liebe Mitglieder des VDBA,
der ICES Advice zum Aal vom 04.11.2021, der eine Einstellung der Fischerei und von Besatzmaßnahmen für 2022 fordert, macht ein konzertiertes und zeitnahes Handeln aller Fischereiverbände, Mitglieder und Einzelmitglieder erforderlich. Wir bitten unsere Mitglieder um Unterstützung für eine konsequente Abwendung dieser Empfehlung!
Landesfischereiverband NS, DFV, DAFV, VDBA, IFEA u.a. Mitstreiter haben bereits erste Stellungnahmen und Aufrufe um Unterstützung gemeinsam erarbeitet und versendet. Die Adressaten sind in den in der Anlage beigefügten Dokumenten ersichtlich.
Bitte nutzen und verwenden Sie nach Bedarf alle beigefügten Dokumente, die darin aufgeführten Befürchtungen, Argumente und Konsequenzen original oder auszugsweise für die Übermittlung an Ihre Ministerpräsidenten, zuständigen Ministerien, Fischereireferenten sowie an bekannte unser Anliegen unterstützende Europa-, Bundes-, und Landesabgeordnete und weitere. Dabei ist ein kurzfristiges Handeln unablässig, denn folgen Kommission und Rat der Empfehlung des ICES vielleicht schon in der Ratssitzung im Dezember wird alles zu Nichte gemacht, was bislang in Umsetzung der EU-Aal-Verordnung 1100/2007 für die Wiederauffüllung des Europäischen Aalbestandes geleistet wurde....
(weiter im Text siehe Anlage)
Deshalb müssen wir alle Kräfte mobilisieren, damit sich unsere deutsche Vertretung in Brüssel und insbesondere im Fischereirat für die weitere Umsetzung der EU-Aal-VO und der genehmigten Aalmanagementpläne zur Wiederauffüllung des europäischen Aalbestandes und dessen nachhaltige Nutzung einsetzt.
Alle, die seit 2007 europaweit aktiv an der Umsetzung der Ziele der EU-Aal-Verordnung arbeiten, haben einen Anspruch auf einen Vertrauensschutz, die Würdigung ihrer Leistungen und eine Teilhabe am sich abzeichnenden Erfolg. Dazu zählt auch das BMEL, dass sich seinerzeit im Jahr 2007 unter Minister Seehofer für die Verabschiedung der EU-Aal-VO eingesetzt und bis heute deren Umsetzung aktiv unterstützt hat.
Viel Erfolg und Danke für die Unterstützung
Ronald Menzel
Vizepräsident
Spartenleiter Seen- und Flussfischerei
der ICES Advice zum Aal vom 04.11.2021, der eine Einstellung der Fischerei und von Besatzmaßnahmen für 2022 fordert, macht ein konzertiertes und zeitnahes Handeln aller Fischereiverbände, Mitglieder und Einzelmitglieder erforderlich. Wir bitten unsere Mitglieder um Unterstützung für eine konsequente Abwendung dieser Empfehlung!
Landesfischereiverband NS, DFV, DAFV, VDBA, IFEA u.a. Mitstreiter haben bereits erste Stellungnahmen und Aufrufe um Unterstützung gemeinsam erarbeitet und versendet. Die Adressaten sind in den in der Anlage beigefügten Dokumenten ersichtlich.
Bitte nutzen und verwenden Sie nach Bedarf alle beigefügten Dokumente, die darin aufgeführten Befürchtungen, Argumente und Konsequenzen original oder auszugsweise für die Übermittlung an Ihre Ministerpräsidenten, zuständigen Ministerien, Fischereireferenten sowie an bekannte unser Anliegen unterstützende Europa-, Bundes-, und Landesabgeordnete und weitere. Dabei ist ein kurzfristiges Handeln unablässig, denn folgen Kommission und Rat der Empfehlung des ICES vielleicht schon in der Ratssitzung im Dezember wird alles zu Nichte gemacht, was bislang in Umsetzung der EU-Aal-Verordnung 1100/2007 für die Wiederauffüllung des Europäischen Aalbestandes geleistet wurde....
(weiter im Text siehe Anlage)
Deshalb müssen wir alle Kräfte mobilisieren, damit sich unsere deutsche Vertretung in Brüssel und insbesondere im Fischereirat für die weitere Umsetzung der EU-Aal-VO und der genehmigten Aalmanagementpläne zur Wiederauffüllung des europäischen Aalbestandes und dessen nachhaltige Nutzung einsetzt.
Alle, die seit 2007 europaweit aktiv an der Umsetzung der Ziele der EU-Aal-Verordnung arbeiten, haben einen Anspruch auf einen Vertrauensschutz, die Würdigung ihrer Leistungen und eine Teilhabe am sich abzeichnenden Erfolg. Dazu zählt auch das BMEL, dass sich seinerzeit im Jahr 2007 unter Minister Seehofer für die Verabschiedung der EU-Aal-VO eingesetzt und bis heute deren Umsetzung aktiv unterstützt hat.
Viel Erfolg und Danke für die Unterstützung
Ronald Menzel
Vizepräsident
Spartenleiter Seen- und Flussfischerei
25.11.2021
Traditionelle Karpfenteichwirtschaft in Bayern – Immaterielles Kulturerbe!
UNESCO erkennt Karpfenteichbewirtschaftung als schützenswertes Kulturgut an
Traditionelle Karpfenteichwirtschaft in Bayern – Immaterielles Kulturerbe!
Karpfen und Teiche prägen Bayern, vor allem Franken und die Oberpfalz, seit mehr als 1000 Jahren. Seit vielen Generationen arbeiten Teichwirte in Einklang mit der Natur, sie erzeugen Karpfen und verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Erst durch die Arbeit des Menschen und die traditionelle Bewirtschaftung entstanden dabei die Teichgebiete, die heute zu den ökologisch wertvollsten und artenreichsten Kultur-Landschaften unserer bayerischen Heimat zählen. Nachhaltigkeit, Schutz der Umwelt und das Tierwohl waren und sind in der Teichwirtschaft immer selbstverständlich. Umfangreiches Wissen, Erfahrungen und Können zur Teichwirtschaft wurden über Jahrhunderte in den Fischerfamilien erarbeitet, bewahrt und von Generation zu Generation weitergegeben.
Bräuche, Feste und Traditionen, Naturerlebnis und Genuss rund um die Teichwirtschaft und den Karpfen haben sich im Lauf der Zeit entwickelt und bereichern das Leben in Bayern.
Die traditionelle Karpfenteichwirtschaft in Bayern wurde deshalb im Jahr 2020 in die Liste „Immaterielles Kulturerbe in Bayern“ und im Jahr 2021 sogar in die UNESCO-Liste „Immaterielles Kulturerbe in Deutschland“ aufgenommen.
Auftrag und Verpflichtung muss es sein, das Kulturerbe Karpfenteichwirtschaft zu erhalten!
Bild (v.l.n.r.): Prof. Dr. Christoph Wulf (Deutsche UNESCO-Kommission) und Dr. Hildegard Kaluza (Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW), Alfred Stier und Hans Klupp (Karpfenzüchter)
Bild: © Deutsche UNESCO-Kommission / Bettina Engel-Albustin
Karpfen und Teiche prägen Bayern, vor allem Franken und die Oberpfalz, seit mehr als 1000 Jahren. Seit vielen Generationen arbeiten Teichwirte in Einklang mit der Natur, sie erzeugen Karpfen und verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Erst durch die Arbeit des Menschen und die traditionelle Bewirtschaftung entstanden dabei die Teichgebiete, die heute zu den ökologisch wertvollsten und artenreichsten Kultur-Landschaften unserer bayerischen Heimat zählen. Nachhaltigkeit, Schutz der Umwelt und das Tierwohl waren und sind in der Teichwirtschaft immer selbstverständlich. Umfangreiches Wissen, Erfahrungen und Können zur Teichwirtschaft wurden über Jahrhunderte in den Fischerfamilien erarbeitet, bewahrt und von Generation zu Generation weitergegeben.
Bräuche, Feste und Traditionen, Naturerlebnis und Genuss rund um die Teichwirtschaft und den Karpfen haben sich im Lauf der Zeit entwickelt und bereichern das Leben in Bayern.
Die traditionelle Karpfenteichwirtschaft in Bayern wurde deshalb im Jahr 2020 in die Liste „Immaterielles Kulturerbe in Bayern“ und im Jahr 2021 sogar in die UNESCO-Liste „Immaterielles Kulturerbe in Deutschland“ aufgenommen.
Auftrag und Verpflichtung muss es sein, das Kulturerbe Karpfenteichwirtschaft zu erhalten!
Bild (v.l.n.r.): Prof. Dr. Christoph Wulf (Deutsche UNESCO-Kommission) und Dr. Hildegard Kaluza (Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW), Alfred Stier und Hans Klupp (Karpfenzüchter)
Bild: © Deutsche UNESCO-Kommission / Bettina Engel-Albustin
25.11.2021
Fallstudie Portionsforellen in der EU, Vergleich Polen, Deutschland, Italien
EUMOFA über die Preisstrukturen innerhalb der Lieferketten
Die EUMOFA (Europäische Marktbeobachtungsstelle für Fischerei und Aquakultur) hat eine Fallstudie erstellt, die die Unterschiede in der Kostenstruktur der Forellenproduktion in Polen, Deutschland und Italien beschreibt. Ebenso wird eine Prognose der Markttendenzen für die europäische Forellenproduktion abgegeben.
20.11.2021
Bestimmungen zur Coronapandemie vom 18.11.2021
Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zu den Coronaschutzmaßnahmen
Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am 18.11.2021 umfassende Änderungen hinsichtlich der Coronaschutzmaßnahmen beschlossen. Im beigefügten Dokument finden Sie die bundesweiten Bestimmungen. Für einzelne Bundesländer gelten ggf. noch weitere Einschränkungen.
17.11.2021
Fokusgruppe Prädatoren gegründet
Neue Arbeitsgruppe des AAC (Aquaculture Advisory Council)
Auf Initiative des VDBA wurde auf europäischer Ebene, unter dem Dach des AAC (Aquaculture Advisory Council) eine neue Fokusgruppe zum Thema Prädatoren und deren Auswirkungen auf die Fischzucht, gegründet. Zusammen mit Vertretern unserer Branche aus Österreich, Rumänien und Tschechien haben wir nun eine Papier verfasst, das die brisante aktuelle Situation der Teichwirtschaft und die künftige Entwicklung betrachtet. Es dient als Grundlage für die anstehenden Diskussionen mit der GD Umwelt und GD Mare bezüglich Biodiversitätsstrategie und ähnlichen brisanten Themen.
Bei dem AAC handelt es sich um eine Gruppierung die zu 40% von NGOs besetzt ist, 60% stellen die Branchenvertreter. Da immer Konsens erforderlich ist, sind mache Forderungen nicht so dringlich formuliert wie es uns Branchenvertretern wichtig gewesen wäre.
Bei dem AAC handelt es sich um eine Gruppierung die zu 40% von NGOs besetzt ist, 60% stellen die Branchenvertreter. Da immer Konsens erforderlich ist, sind mache Forderungen nicht so dringlich formuliert wie es uns Branchenvertretern wichtig gewesen wäre.
12.11.2021
Gemeinsamer Aufruf des DFV, des VDBA, des DAFV und der IFEA zur Weiterführung der Maßnahmen zur Wiederauffüllung des Europäischen Aalbestand
Am 04. November 2021 veröffentlichte der Internationaler Rat für Meeresforschung (ICES) eine sehr fragwürdige und drastische Empfehlung für den Europäischen Aal. Darin wird für 2022 die vollständige Schließung aller Aalfischereien auf alle Lebensstadien, sowohl für marine als auch für Binnengewässer empfohlen, de facto also die Einstellung der Berufs- und der Freizeit-fischerei. Der ICES empfiehlt damit ausdrücklich auch die Einstellung jeglicher Aalbesatzmaßnahmen.
29.10.2021
ABGESAGT!! 23.-24.11.2021 Mitgliederversammlung anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des VDBA in Oberschleißheim.
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des VDBA (gegründet am 22.10.1971 als VBDI) findet von 23 bis 24.November 2021 eine Mitgliederversammlung sowie ein Einzelmitgliedertreffen in Oberschleißheim statt. Die Anmeldung kann bis 05. November 2021 an info@VDBA.org oder per Fax an 03381 403245 erfolgen (Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf legitimierte Vertreter der Mitgliedsverbände und Einzelmitglieder).
Neben organisatorischen Programmpunkten werden die Young Fishermen sowie die überarbeitete Homepage des VDBA vorgestellt. Ebenso werden aktuelle Themen wie die Umsetzung der Richtlinien zum Schadensausgleich durch Otter und Kormoran oder das neue EU-Tiergeseundheitsgesetz besprochen.
Neben diesen Programmpunkten kommen auch das gemütliche Beisammensein und der informelle Austausch mit den Kollegen nicht zu kurz. Die Flugwerft Oberschleißheim, eine Außenstelle des Deutschen Museums, wird am nach dem offiziellen Programm besichtigt. Im Anschluss daran folgt ein gemeinsames Abendessen. Am 24.November folgt ein Rundgang durch die Münchner Innenstadt, bei dem natürlich das Jagd- und Fischereimuseum nicht fehlen darf.
Bitte beachten: Die Adresse ist Mittenheimer Straße 4 in 85764 Oberschleißheim.
Anreise mit dem Auto: Einige Navigationsgeräte leiten Sie in den Ortsteil Mittenheim, deshalb ist es wichtig, die gesamte Adresse inklusive Postleitzahl einzugeben.
Außerdem ist die Ortsdurchfahrt Oberschleißheim derzeit wegen Brückenbauarbeiten gesperrt. Am einfachsten fahren Sie von der A92, A9 oder A99 über die B471 bis nach Oberschleißheim.
Anreise mit Zug oder Flugzeug: Sie erreichen Oberschleißheim auch einfach per S-Bahn (Linie S1) aus dem Stadtzentrum von München oder direkt vom Münchner Flughafen.
Neben organisatorischen Programmpunkten werden die Young Fishermen sowie die überarbeitete Homepage des VDBA vorgestellt. Ebenso werden aktuelle Themen wie die Umsetzung der Richtlinien zum Schadensausgleich durch Otter und Kormoran oder das neue EU-Tiergeseundheitsgesetz besprochen.
Neben diesen Programmpunkten kommen auch das gemütliche Beisammensein und der informelle Austausch mit den Kollegen nicht zu kurz. Die Flugwerft Oberschleißheim, eine Außenstelle des Deutschen Museums, wird am nach dem offiziellen Programm besichtigt. Im Anschluss daran folgt ein gemeinsames Abendessen. Am 24.November folgt ein Rundgang durch die Münchner Innenstadt, bei dem natürlich das Jagd- und Fischereimuseum nicht fehlen darf.
Bitte beachten: Die Adresse ist Mittenheimer Straße 4 in 85764 Oberschleißheim.
Anreise mit dem Auto: Einige Navigationsgeräte leiten Sie in den Ortsteil Mittenheim, deshalb ist es wichtig, die gesamte Adresse inklusive Postleitzahl einzugeben.
Außerdem ist die Ortsdurchfahrt Oberschleißheim derzeit wegen Brückenbauarbeiten gesperrt. Am einfachsten fahren Sie von der A92, A9 oder A99 über die B471 bis nach Oberschleißheim.
Anreise mit Zug oder Flugzeug: Sie erreichen Oberschleißheim auch einfach per S-Bahn (Linie S1) aus dem Stadtzentrum von München oder direkt vom Münchner Flughafen.
27.10.2021
Deutscher Fischereitag 2021 in Emden
02.11.2021 - 04.11.2021
Der Deutsche Fischereitag 2021 wird wie geplant als Präsenzveranstaltung vom 02. bis 04. November 2021 in Emden stattfinden. Es werden auch einige Veranstaltungen als Hybrid-Veranstaltungen zur Verfügung stehen, d.h. es wird neben der persönlichen Teilnahme auch die Möglichkeit geben, diese Veranstaltungen online zu verfolgen. Diese Veranstaltungen sind im Programm gekennzeichnet.
Wichtige Hinweise
Anmeldung:
Es wird gebeten, sich für die anmeldepflichtigen Veranstaltungen am Deutschen Fischereitag (Eröffnung, Landestypischer Abend und Begleitprogramm) bei der Geschäftsstelle des Deutschen Fischerei-Verbandes, Venusberg 36, 20459 Hamburg, entweder per beigefügter Postkarte (Gelber Zettel) oder per E-Mail:
info@deutscher-fischerei-verband.de bis zum 25.10.2021 (Einsendeschluss) verbindlich anzumelden.
Programm Zum Deutschen Fischerei-Verband
Wichtige Hinweise
Anmeldung:
Es wird gebeten, sich für die anmeldepflichtigen Veranstaltungen am Deutschen Fischereitag (Eröffnung, Landestypischer Abend und Begleitprogramm) bei der Geschäftsstelle des Deutschen Fischerei-Verbandes, Venusberg 36, 20459 Hamburg, entweder per beigefügter Postkarte (Gelber Zettel) oder per E-Mail:
info@deutscher-fischerei-verband.de bis zum 25.10.2021 (Einsendeschluss) verbindlich anzumelden.
Programm Zum Deutschen Fischerei-Verband
19.12.2020
Leitsätze der Bay. Landesanstalt zum Abfischen in Zeiten der Corona- Pandemie
Leitsätze beim Abfischen in der Teichwirtschaft vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie
Stand: 17.12.2020
Derzeit laufen zahlreiche Abfischungen von Fischteichen. Die Abfischungen sind aus betrieblichen und tierschutzrechtlichen Gründen durchzuführen. Gleichzeitig steigen allerorts die Corona-Infektionszahlen. Damit die Abfischungen entsprechend den rechtlichen Vorgaben durchgeführt werden, sind die nachfolgenden Leitsätze zu beachten. Vergleichbares gilt auch für alle anderen Fischerzeugungsbetriebe.
Zum Schutz der Gesundheit der Menschen sind vor dem Hintergrund der Corona-Krise die vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) aktuell verfügten Bestimmungen (https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen) und eventuelle weitere Allgemeinverfügungen der örtlichen Behörden zu beachten. Gegebenenfalls ist bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde nachzufragen, ob eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist.
Außerdem sind stets die derzeit allgemein gültigen Schutzmaßnahmen, insbesondere Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen, zu beachten.
Abfischen:
Fischverkauf:
Wir bitten alle Teichwirte, darauf zu achten, dass diese Regeln eingehalten werden!
Bitte bleiben Sie gesund!
herausgegeben der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und dem Institut für Fischerei, Starnberg.
Derzeit laufen zahlreiche Abfischungen von Fischteichen. Die Abfischungen sind aus betrieblichen und tierschutzrechtlichen Gründen durchzuführen. Gleichzeitig steigen allerorts die Corona-Infektionszahlen. Damit die Abfischungen entsprechend den rechtlichen Vorgaben durchgeführt werden, sind die nachfolgenden Leitsätze zu beachten. Vergleichbares gilt auch für alle anderen Fischerzeugungsbetriebe.
Zum Schutz der Gesundheit der Menschen sind vor dem Hintergrund der Corona-Krise die vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) aktuell verfügten Bestimmungen (https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen) und eventuelle weitere Allgemeinverfügungen der örtlichen Behörden zu beachten. Gegebenenfalls ist bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde nachzufragen, ob eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist.
Außerdem sind stets die derzeit allgemein gültigen Schutzmaßnahmen, insbesondere Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen, zu beachten.
Abfischen:
- Abfischen mit so wenigen Personen wie möglich.
- Die Helfer stammen möglichst aus einer häuslichen Gemeinschaft. In jedem Fall soll der Helferkreis auf ein Minimum beschränkt werden.
- Wo immer möglich den Abstand von 1,5 m einhalten.
- Falls der Abstand von 1,5 m nicht einzuhalten ist, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
- Nicht am Abfischen beteiligte Personen sind aufzufordern, den notwendigen Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten.
Fischverkauf:
- Kunden sollen nach Möglichkeit zeitlich getrennt bedient werden und zumindest örtlich getrennt voneinander mit Abstand von mindestens 1,5 m warten.
- Kunden sollen am Teichdamm am besten in den jeweiligen Fahrzeugen sitzen bleiben.
- Immer wenn der Abstand von 1,5 m zu anderen Personen nicht sicher eingehalten werden kann, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Beim Kundenkontakt besteht Maskenpflicht bei Kunden und Verkäufer.
- Bargeldloser Zahlungsverkehr ist anzustreben.
- Bei notwendiger Barzahlung direkten menschlichen Kontakt vermeiden.
Wir bitten alle Teichwirte, darauf zu achten, dass diese Regeln eingehalten werden!
Bitte bleiben Sie gesund!
herausgegeben der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und dem Institut für Fischerei, Starnberg.
19.12.2020
Die Jahreshauptversammlung des VDBA fand 2020 virtuell statt.
Jahrshauptversammlung VDBA 2020
Die Jahreshauptversammlung 2020 des VDBA wurde, wie so viele andere Veranstaltungen „ins Web“ verlegt.
die Agenda inclusive der anstehenden Wahlen, wurde unproblematisch abgearbeitet.
Neben den üblichen, notwendigen Regularien wurden folgende Themen diskutiert:
Die Vollständige Tagesordnung: VDBA 03.12.2020. zum Download.
inzwischen hat der Runde Tisch Aquakultur am BMEL ebenfalls virtuell statt gefunden. Dazu gibt es demnächst eine eigene Mitteilung. Dort wird v.a. ausführlich auf den Beitrag von Dr. Heinrich hinsichtlich des neuen Tiergesundheitgesetzes eingegangen!
Nachdem heuer unser langjähriges Präsidiumsmitglied Wolfgang Stiehler verstarb, wurde Torben Heese als stellvertretender Spartenleiter , Karpfenteichwirtschaft, nachgewählt.
Für T. Heese rückte durch Wahl in der Vollversammlung Frau Anna Klupp in die Sparte Karpfentw. nach.
Glückwunsch an Beide zur Wahl! (s. auch Bild oben)
— der Präsident berichtete über einige Aktivitäten hinsichtlich des künftigen Internetauftrittes:
Ziel ist es, dass der VDBA mit seinem Webauftritt nicht nur für Mitglieder unserer Branche interessant sein soll. Auch Verbraucher, Presse, und Politiker sollen bei uns seriöse Informationen erhalten.
Dazu wird
die Agenda inclusive der anstehenden Wahlen, wurde unproblematisch abgearbeitet.
Neben den üblichen, notwendigen Regularien wurden folgende Themen diskutiert:
- CORONA – Auswirkungen auf Bifi und Aquakultur
- Runder Tisch Aquakultur 07.12.2020
- Tiergesundheitsrecht
- Hochwasserschutz versus Teichdämme (DIN 19700)
- Kormoran, Otter, Biber
- Aal
- EMFAF
- Perspektive des VDBA
Die Vollständige Tagesordnung: VDBA 03.12.2020. zum Download.
inzwischen hat der Runde Tisch Aquakultur am BMEL ebenfalls virtuell statt gefunden. Dazu gibt es demnächst eine eigene Mitteilung. Dort wird v.a. ausführlich auf den Beitrag von Dr. Heinrich hinsichtlich des neuen Tiergesundheitgesetzes eingegangen!
Nachdem heuer unser langjähriges Präsidiumsmitglied Wolfgang Stiehler verstarb, wurde Torben Heese als stellvertretender Spartenleiter , Karpfenteichwirtschaft, nachgewählt.
Für T. Heese rückte durch Wahl in der Vollversammlung Frau Anna Klupp in die Sparte Karpfentw. nach.
Glückwunsch an Beide zur Wahl! (s. auch Bild oben)
— der Präsident berichtete über einige Aktivitäten hinsichtlich des künftigen Internetauftrittes:
Ziel ist es, dass der VDBA mit seinem Webauftritt nicht nur für Mitglieder unserer Branche interessant sein soll. Auch Verbraucher, Presse, und Politiker sollen bei uns seriöse Informationen erhalten.
Dazu wird
- die gesamte Website wird durch eine Agentur inhaltlich und optisch neu aufgebaut, sowie der Provider gewechselt.
- der Newsletter wird graphisch aufbereitet und mit neuer Software so gestaltet, dass er auf allen Medien gut lesbar sein wird.
- die Themen werden ausgeweitet und künftig wird mit mehreren Agenturen und Institutionen die Arbeit ausgetauscht. Die Ergebnisse werden jeweils gemeinsam veröffentlicht. Dies erhöht unsere Sichtbarkeit im Netz.
- im Jahr 2021 werden wir mit einem extra NL auf die Neue Website Bezug nehmen!
18.12.2020
So verbessert der Karpfen die Welt! ein Video Beitrag von Dr. Kainz, Österreich
Alleine im Waldviertel werden jährlich 500 Tonnen
zum Video gehts hier!
Alleine im Waldviertel werden jährlich 500 Tonnen Karpfen abgefischt. Dr. Martin Kainz, Ökologe am Forschungszentrum WasserCluster Lunz, erforscht die Karpfenteiche Österreichs. „Denn die Teiche, so das Ergebnis seiner Untersuchungen, tragen maßgeblich zum Klimaschutz und zur Biodiversität in ihrer Umgebung bei.“
Von Dr. Kainz wird demnächst die gesamte Studie zur ökologischen Bedeutung der Karpfenteichwirtschaft veröffentlicht.Sie wird natürlich umgehend auch hier zu finden sein.
Alleine im Waldviertel werden jährlich 500 Tonnen Karpfen abgefischt. Dr. Martin Kainz, Ökologe am Forschungszentrum WasserCluster Lunz, erforscht die Karpfenteiche Österreichs. „Denn die Teiche, so das Ergebnis seiner Untersuchungen, tragen maßgeblich zum Klimaschutz und zur Biodiversität in ihrer Umgebung bei.“
Von Dr. Kainz wird demnächst die gesamte Studie zur ökologischen Bedeutung der Karpfenteichwirtschaft veröffentlicht.Sie wird natürlich umgehend auch hier zu finden sein.
02.12.2020
Otter, das Tier des Jahres 2021, die Einschätzung aus Brandenburg
Zum Thema Otter unter dem Aspekt, dass dieser zum Tier des Jahres
Zum Thema Otter unter dem Aspekt, dass dieser zum Tier des Jahres gewählt wurde.
Ein Beitrag aus dem soeben erschienenen Jahresbericht 2019 des DFV.
Interview mit Lars De ttmann, Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes Berlin Brandenburg
Sind Otter inzwischen flächendeckend in Deutschland vorhanden?
Noch nicht. Anfang der 90’er Jahre war der Fischotter in Deutschland nur noch im Nordosten in den heutigen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und im Norden Sachsens vertreten. Der Straßenverkehr und Umweltgifte in der Landschaft hatten die Bestände zuvor massiv reduziert und die Ottervorkommen in weiten Teilen Deutschlands ausgelöscht. Der gezielte Umbau von Brücken und Durchlässen, über die Straßen Gewässer kreuzen, half bei der Reduzierung der Verkehrsopfer, während strenger Auflagen beim Gebrauch giftiger Chemikalien deren Konzentration in der Umwelt und damit auch die schädliche Wirkung auf den Fischotter drastisch verringerten. Im Ergebnis breitet sich die Fischotter seit nunmehr 30 Jahren vor allem entlang von Flussläufen wieder gen Westen und Norden aus. Inzwischen hat er über Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Nordrheinwestfahlen und Niedersachsen die Grenze zu den Niederlanden erreicht und im Norden die Lücke zu den Ottervorkommen in Dänemark geschlossen. Auch Thüringen und Hessen haben wieder Ottervorkommen. Zugleich erfolgt ausgehend von tschechischen Fi- schottervorkommen über den Bayerischen Wald und die Oberpfalz die Westausbreitung in Süddeutschland. Lediglich im Saarland und Rheinlandpfalz gibt es nach derzeitigem Stand bisher noch keine Otter- nachweise.
Wo sind die „Hotspots“ und welche Konflikte gibt es?
Ein Blick auf die Verbreitungskarte zeigt, dass im Nordosten Deutschlands nahezu flächendeckend Fischotter unterwegs sind. Ähnlich sieht es inzwischen im Bayerischen Wald und der Oberpfalz aus. Wahre
„Hotspots“ sind dabei stets die Regionen, in denen es noch Karpftenteichwirtschaft und damit Teichgebiete gibt. Fischteiche in der Landschaft erhöhen die Lebensraumka-
pazität für den Fischotter, so dass die Vorkommen dort entsprechend dichter sind. Das führt zu erheblichen Schäden in den Fischbeständen sowohl in Teichen, als auch in umliegenden natürlichen Gewässern und damit zu entsprechenden Konflikten mit Teichwirten und Sportfischern. Für die Erwerbsfischerei in Flüssen und Seen war der Fischotter an sich bislang nie ein Problem. Das änderte sich, als Otterschützer zur Selbstdarstellung und Spendenakquise eine Kampagne gegen die Reusenfischerei starteten. Obwohl sich nur extrem selten Fischotter in eine Reuse verirren und dort verenden, wurde dieses Risiko in der Kam- pagne als extreme Gefahr für die Fischotter dargestellt. Dass ausgerechnet im Nordosten Deutschlands, wo der Fischotter nie wirklich gefährdet war, auch die höchste Dichte an Fischereibetrieben mit entsprechend intensiver Reusenfischerei in ganz Deutschland besteht und sich der Fischotter von hier aus vorbei an den Reusen der Fischer wieder ausbreitet, wurde von den Machern der Kampagne unterschlagen. Gleiches gilt für den Umstand, dass auch heute noch der Straßenverkehr für 80 bis 90% der Totfunde von Fischottern verant- wortlich ist. Erst unter den übrigen Todesursachen taucht dann unter anderem auch das Ertrinken in Fischreusen auf. In dieser Statistik wird jedoch nicht zwischen den Reusen der Erwerbsfischerei und den von Fischwilderern gestellten Kleinreusen unterschieden. Im Ergebnis wird heute verbreitet versucht, unter Berufung auf das europäische Artenschutzrecht die Reusenfischerei „zum Schutz des Fischotters“ einzuschränken.
Welche Schäden sind schwerwiegender: Der Befall von Teichwirtschaften und die daraus resultierenden Fraßschäden oder der Minderfang in der Fluss- und Seenfischerei u.a. durch otterabweisende Konstruktionen in Reusen („Otterkreuze“)?
Beide gefährden die wirtschaftliche Existenz von Betrieben, sind aber nur schwer miteinander zu vergleichen. Während in Teichwirtschaften der Fischotter selbst massive Verluste verursacht, leidet die Fluss- und Seenfischerei unter den überzogenen Auslegungen europäischer Vorschriften zum Artenschutz. Letztere gehen so weit, dass Vertreter von Behörden und Naturschutzverbänden eine vorsätzliche Tötungsabsicht unterstellen, sofern der Fischer in einer Reuse einen Fischotter fangen sollte. Inzwischen entwickelte „Ausstiegshilfen“ für Kleinreusen entschärfen den Konflikt nur teilweise, weil z. B. das Land Berlin im Entwurf zur Novelle der Landesfischereiordnung verlangt, dass der Fischer das Einschwimmen von Fischottern verhindern oder das Überleben einschwimmender Otter „gewährleisten“ muss. In dieser Absolutheit ist das auch mit den derzeit zur Verfügung stehenden Ausstiegshilfen nicht machbar und der Fischer müsste sei- ne Reusen im Schuppen hängen lassen.
Wie bewähren sich Ausstiegsmöglichkeiten („Reißnaht“) in der praktischen Fischerei?
Der Einbau der in Tierversuchen mit Fi- schottern unter eher realitätsfernen Bedingungen getesteten Ausstieghilfen verursacht neben den Kosten für Beschaffung und Einbau natürlich Probleme im Handling der Reusen. Am Steinhuder Meer hat der Haupterwerbsfischer vor dem Hintergrund der Vorgaben auf die Fortführung des Fischereipachtverhältnisses verzichtet. Damit dürfte die Frage hinreichend beantwortet sein.
Es ist unstrittig, dass viel mehr Otter im Straßenverkehr sterben als in Fanggerä- ten der Fischerei, und der Bestand wächst trotzdem. Macht es da Sinn, die Fischerei- betriebe so zu schwächen?
Wie zuvor schon erwähnt, wird in den Totfundstatistiken jeder ertrunkene Fischotter als „Reusenopfer“ geführt, ohne zu differenzieren, ob er in legal gestellten Reusen oder in unsachgemäß aufgestellten Reusen von Fischwilderern verendet ist. Selbst in Summe bewegt sich der Anteil der „Reusenopfer“ im Bereich von 5 bis 10 % aller getöteten Fischotter, während allein der Straßenverkehr für rund 90 % verantwortlich ist. Jetzt interessieren sich Fischwilderer mit ihren illegal gestellten Reusen ebenso wenig für die Vorschriften des Fischereirechts, wie sie auch rechtliche Regelungen des Arten- schutzrechtes ignorieren. Sie nutzen weiter die im Handel frei verkäuflichen Reusenmodelle für ihr illegales Treiben, ohne sich um den Otterschutz zu scheren.
Reuse mit Reißnaht als Ausstiegshilfe für Fischotter
Im Gegensatz zu den deutlich größer dimensionierten Reusen der Erwerbsfischer sind die zur Fischwilderei verwendeten Kleinreusen für Fischotter gefährlich, weil bereits gefangene Fische hier für ihn vom Reuseneingang aus sichtbar sind und wie Köder wirken. Die in solchen illegal gestellten Reusen verendeten Otter landen als Reusenopfer in der Statitik und dienen als Argument für die Beschränkungen von Erwerbsfischern. Dem Fischotter hilft das nicht – im Gegenteil. Wo derart überzogene Vorgaben den Erwerbsfischern den Rest geben und sie vom Wasser verdrängen, sinkt für die Fischwilderer das Risiko entdeckt zu werden, ganz dramatisch. Die logische Folge: eher mehr illegal und dilettantisch gestellte Kleinreusen, womit das Risiko für die Fischotter zwangsläufig zunimmt.
Bei den Teichwirtschaften können massive, aufwendige Zaunkonstruktionen gebaut werden, um den Ottern den Zugang zu den Teichen unmöglich zu machen. Wie hoch sind die Kosten?
Die Kosten sind von der Art des Zaunes und von den Geländebedingungen vor Ort abhängig. Um Fischotter wirklich dauerhaft und sicher aus Teichen heraus zu halten, sind entsprechend stabile Anlagen erforderlich, die zudem ausreichend tief in den Boden eingelassen werden müssen. Eine solche Zaunanlage zum Schutz von insgesamt 3,2 ha Teichflächen hat im brandenburgischen Fünfeichen insgesamt 124.000 € gekostet. Das entspricht Kosten pro Hektar Teichfläche von 38.750 € und vermittelt, in welchen Dimensionen man sich bewegen würde, wenn man die insgesamt mehr als 23.000 ha Teichflächen in Deutschland ottersicher einzäunen wollte.
Das bayerische Ottermanagement mit spezifischen Otterberatern und hohem Einsatz von Geldmitteln ist bundesweit am besten entwickelt, läuft das erfolgreich?
Im Freistaat Bayern hat man frühzeitig reagiert und die zum Thema Fischotter streitenden Parteien an einen Tisch geholt. Im Bewusstsein, dass Teichwirtschaft nicht nur ein Stück Kulturgut und Wertschöpfung ist, sondern auch die Grundlage für die große Artenvielfalt in den Teichgebieten bildet, wurde und wird nach gangbaren Lösungen gesucht. Entschädigungsregelungen, die finanzielle Förderung von Zaunanlagen und die Beratung der betroffenen Teichwirte sind durchaus Erfolge. Am Ende kuriert man damit aber noch immer nur am Symptom, weil tatsächlich zufriedenstellende Lösungen ohne gezielte, lokale Eingriffe in die Ottervorkommen allein aus finanziellen Gründen – siehe Kosten für die Einzäunung – nicht flächendeckend umsetzbar sind. Der Versuch der Verwaltung, in der Oberpfalz einzelne Fischotter in Teichgebieten entnehmen zu lassen, wird derzeit von zwei anerkannten Naturschutzverbänden per Klage blockiert. Es bleibt deshalb abzuwarten, wie diese juristische Auseinandersetzung ausgeht.
Gibt es eine wachsende Zahl von Betriebsaufgaben?
Ja! Der Begriff Teichwirtschaft an sich sagt ja schon, dass es um das Erwirtschaften von letztlich finanziellen Erträgen geht. Anders sind die Teichgebiete als Betriebsanlagen, Landschaftselemente und wichtige Habitate für geschützte Arten nicht zu erhalten. Das erwirtschaften nachhaltiger Erträge gelingt inzwischen flächendeckend nicht mehr, so- fern die öffentliche Hand nicht mit finanziellen Beihilfen unterstützt. Kernproblem sind die insgesamt enormen Fischverluste durch Prädation. Dabei ist der Fischotter neben Kormoran, Silberreiher und vielen anderen Fischliebhabern nur einer von vielen Akteuren am und im Teich. In der Summe ist die Teichwirtschaft deshalb in- zwischen zur Fütterung von geschützten Arten mit Fisch verkommen. Dieser Um- stand, die entsprechende Frustration bei den Teichwirten und finanzielle Zwänge führten inzwischen zur Aufgabe einer Vielzahl von Teichen und Teichgebieten. Damit verschwinden neben der Wertschöpfung gerade im ländlichen Raum auch Biotope, auf die eine Vielzahl gefährdeter Tier und Pflanzenarten angewiesen sind. Wir erleben gerade, wie die zu unflexiblen Regelungen des europäischen Artenschutzrechts an ihrem eigenen Erfolg scheitern. Die ambitionierten Ziele der Biodiversitätsstrategie 2030, die von der EU-Kommission in die- sem Ausgegeben wurden, werden wir nicht nur in Deutschland schon allein wegen dem Verschwinden einer Vielzahl von Teichen/Teichgebieten und den dort lebenden, nach EU-Recht geschützten Arten, sicher verfehlen.
Wie ist die Stimmungslage in den Betrieben, die von Otterschäden betroffen sind?
Natürlich verstärkt die Problematik den ohnehin schon vorhandenen Frust auf die teils weltfremden Schutzbestimmungen der EU und die Verwaltungsstrukturen, die diese Bestimmungen umsetzen müssen. Zu sehen, wie der eigene und tatsächlich erhebliche Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt in Form der Teichbewirtschaftung ausgerechnet durch absolut dogmatische Schutzvorschriften aus Brüssel zunichte- gemacht wird, lässt die Menschen schlicht verzweifeln.
Was wäre konkret zu tun, um das Otterproblem so einzugrenzen, dass nachhaltige Fischerei und Aquakultur hier weiter eine Zukunftsperspektive haben?
Ursprung nicht nur des „Otterproblems“ ist ein Geburtsfehler der europäischen Artenschutzrichtlinien. Sowohl der Vogelschutz- als auch der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie fehlt der an sich zwingend notwendige Automatismus, mit dem sich der Schutzstatus für eine Art umgehend an die tatsächliche Gefährdungssituation dieser Art anpasst. Wo der Schutz erfolgreich war und damit sogar massive Schäden verbunden sind, muss der Schutzstatus regional angepasst und ggf. auch eine Regulierung der betreffenden Art möglich werden. Damit wäre nicht nur der Konflikt um den Fischotter augenblicklich entschärft. Auch bei Kormoran, Biber, Wolf oder Silberreiher würden sich so die nötigen Spielräume eröffnen, die derzeit von interessierten Kreisen mit Ver- weis auf die EU-Vorgaben juristisch blockiert werden. Zugleich würde so verhindert, dass wie bei der Reusenfischerei völlig überzogene Schutzvorschriften eine nach- haltige Befischung be- bzw. verhindern und zugleich die Akzeptanz für Maßnahmen des Artenschutzes ruinieren.
Ein Beitrag aus dem soeben erschienenen Jahresbericht 2019 des DFV.
Interview mit Lars De ttmann, Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes Berlin Brandenburg
Sind Otter inzwischen flächendeckend in Deutschland vorhanden?
Noch nicht. Anfang der 90’er Jahre war der Fischotter in Deutschland nur noch im Nordosten in den heutigen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und im Norden Sachsens vertreten. Der Straßenverkehr und Umweltgifte in der Landschaft hatten die Bestände zuvor massiv reduziert und die Ottervorkommen in weiten Teilen Deutschlands ausgelöscht. Der gezielte Umbau von Brücken und Durchlässen, über die Straßen Gewässer kreuzen, half bei der Reduzierung der Verkehrsopfer, während strenger Auflagen beim Gebrauch giftiger Chemikalien deren Konzentration in der Umwelt und damit auch die schädliche Wirkung auf den Fischotter drastisch verringerten. Im Ergebnis breitet sich die Fischotter seit nunmehr 30 Jahren vor allem entlang von Flussläufen wieder gen Westen und Norden aus. Inzwischen hat er über Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Nordrheinwestfahlen und Niedersachsen die Grenze zu den Niederlanden erreicht und im Norden die Lücke zu den Ottervorkommen in Dänemark geschlossen. Auch Thüringen und Hessen haben wieder Ottervorkommen. Zugleich erfolgt ausgehend von tschechischen Fi- schottervorkommen über den Bayerischen Wald und die Oberpfalz die Westausbreitung in Süddeutschland. Lediglich im Saarland und Rheinlandpfalz gibt es nach derzeitigem Stand bisher noch keine Otter- nachweise.
Wo sind die „Hotspots“ und welche Konflikte gibt es?
Ein Blick auf die Verbreitungskarte zeigt, dass im Nordosten Deutschlands nahezu flächendeckend Fischotter unterwegs sind. Ähnlich sieht es inzwischen im Bayerischen Wald und der Oberpfalz aus. Wahre
„Hotspots“ sind dabei stets die Regionen, in denen es noch Karpftenteichwirtschaft und damit Teichgebiete gibt. Fischteiche in der Landschaft erhöhen die Lebensraumka-
pazität für den Fischotter, so dass die Vorkommen dort entsprechend dichter sind. Das führt zu erheblichen Schäden in den Fischbeständen sowohl in Teichen, als auch in umliegenden natürlichen Gewässern und damit zu entsprechenden Konflikten mit Teichwirten und Sportfischern. Für die Erwerbsfischerei in Flüssen und Seen war der Fischotter an sich bislang nie ein Problem. Das änderte sich, als Otterschützer zur Selbstdarstellung und Spendenakquise eine Kampagne gegen die Reusenfischerei starteten. Obwohl sich nur extrem selten Fischotter in eine Reuse verirren und dort verenden, wurde dieses Risiko in der Kam- pagne als extreme Gefahr für die Fischotter dargestellt. Dass ausgerechnet im Nordosten Deutschlands, wo der Fischotter nie wirklich gefährdet war, auch die höchste Dichte an Fischereibetrieben mit entsprechend intensiver Reusenfischerei in ganz Deutschland besteht und sich der Fischotter von hier aus vorbei an den Reusen der Fischer wieder ausbreitet, wurde von den Machern der Kampagne unterschlagen. Gleiches gilt für den Umstand, dass auch heute noch der Straßenverkehr für 80 bis 90% der Totfunde von Fischottern verant- wortlich ist. Erst unter den übrigen Todesursachen taucht dann unter anderem auch das Ertrinken in Fischreusen auf. In dieser Statistik wird jedoch nicht zwischen den Reusen der Erwerbsfischerei und den von Fischwilderern gestellten Kleinreusen unterschieden. Im Ergebnis wird heute verbreitet versucht, unter Berufung auf das europäische Artenschutzrecht die Reusenfischerei „zum Schutz des Fischotters“ einzuschränken.
Welche Schäden sind schwerwiegender: Der Befall von Teichwirtschaften und die daraus resultierenden Fraßschäden oder der Minderfang in der Fluss- und Seenfischerei u.a. durch otterabweisende Konstruktionen in Reusen („Otterkreuze“)?
Beide gefährden die wirtschaftliche Existenz von Betrieben, sind aber nur schwer miteinander zu vergleichen. Während in Teichwirtschaften der Fischotter selbst massive Verluste verursacht, leidet die Fluss- und Seenfischerei unter den überzogenen Auslegungen europäischer Vorschriften zum Artenschutz. Letztere gehen so weit, dass Vertreter von Behörden und Naturschutzverbänden eine vorsätzliche Tötungsabsicht unterstellen, sofern der Fischer in einer Reuse einen Fischotter fangen sollte. Inzwischen entwickelte „Ausstiegshilfen“ für Kleinreusen entschärfen den Konflikt nur teilweise, weil z. B. das Land Berlin im Entwurf zur Novelle der Landesfischereiordnung verlangt, dass der Fischer das Einschwimmen von Fischottern verhindern oder das Überleben einschwimmender Otter „gewährleisten“ muss. In dieser Absolutheit ist das auch mit den derzeit zur Verfügung stehenden Ausstiegshilfen nicht machbar und der Fischer müsste sei- ne Reusen im Schuppen hängen lassen.
Wie bewähren sich Ausstiegsmöglichkeiten („Reißnaht“) in der praktischen Fischerei?
Der Einbau der in Tierversuchen mit Fi- schottern unter eher realitätsfernen Bedingungen getesteten Ausstieghilfen verursacht neben den Kosten für Beschaffung und Einbau natürlich Probleme im Handling der Reusen. Am Steinhuder Meer hat der Haupterwerbsfischer vor dem Hintergrund der Vorgaben auf die Fortführung des Fischereipachtverhältnisses verzichtet. Damit dürfte die Frage hinreichend beantwortet sein.
Es ist unstrittig, dass viel mehr Otter im Straßenverkehr sterben als in Fanggerä- ten der Fischerei, und der Bestand wächst trotzdem. Macht es da Sinn, die Fischerei- betriebe so zu schwächen?
Wie zuvor schon erwähnt, wird in den Totfundstatistiken jeder ertrunkene Fischotter als „Reusenopfer“ geführt, ohne zu differenzieren, ob er in legal gestellten Reusen oder in unsachgemäß aufgestellten Reusen von Fischwilderern verendet ist. Selbst in Summe bewegt sich der Anteil der „Reusenopfer“ im Bereich von 5 bis 10 % aller getöteten Fischotter, während allein der Straßenverkehr für rund 90 % verantwortlich ist. Jetzt interessieren sich Fischwilderer mit ihren illegal gestellten Reusen ebenso wenig für die Vorschriften des Fischereirechts, wie sie auch rechtliche Regelungen des Arten- schutzrechtes ignorieren. Sie nutzen weiter die im Handel frei verkäuflichen Reusenmodelle für ihr illegales Treiben, ohne sich um den Otterschutz zu scheren.
Reuse mit Reißnaht als Ausstiegshilfe für Fischotter
Im Gegensatz zu den deutlich größer dimensionierten Reusen der Erwerbsfischer sind die zur Fischwilderei verwendeten Kleinreusen für Fischotter gefährlich, weil bereits gefangene Fische hier für ihn vom Reuseneingang aus sichtbar sind und wie Köder wirken. Die in solchen illegal gestellten Reusen verendeten Otter landen als Reusenopfer in der Statitik und dienen als Argument für die Beschränkungen von Erwerbsfischern. Dem Fischotter hilft das nicht – im Gegenteil. Wo derart überzogene Vorgaben den Erwerbsfischern den Rest geben und sie vom Wasser verdrängen, sinkt für die Fischwilderer das Risiko entdeckt zu werden, ganz dramatisch. Die logische Folge: eher mehr illegal und dilettantisch gestellte Kleinreusen, womit das Risiko für die Fischotter zwangsläufig zunimmt.
Bei den Teichwirtschaften können massive, aufwendige Zaunkonstruktionen gebaut werden, um den Ottern den Zugang zu den Teichen unmöglich zu machen. Wie hoch sind die Kosten?
Die Kosten sind von der Art des Zaunes und von den Geländebedingungen vor Ort abhängig. Um Fischotter wirklich dauerhaft und sicher aus Teichen heraus zu halten, sind entsprechend stabile Anlagen erforderlich, die zudem ausreichend tief in den Boden eingelassen werden müssen. Eine solche Zaunanlage zum Schutz von insgesamt 3,2 ha Teichflächen hat im brandenburgischen Fünfeichen insgesamt 124.000 € gekostet. Das entspricht Kosten pro Hektar Teichfläche von 38.750 € und vermittelt, in welchen Dimensionen man sich bewegen würde, wenn man die insgesamt mehr als 23.000 ha Teichflächen in Deutschland ottersicher einzäunen wollte.
Das bayerische Ottermanagement mit spezifischen Otterberatern und hohem Einsatz von Geldmitteln ist bundesweit am besten entwickelt, läuft das erfolgreich?
Im Freistaat Bayern hat man frühzeitig reagiert und die zum Thema Fischotter streitenden Parteien an einen Tisch geholt. Im Bewusstsein, dass Teichwirtschaft nicht nur ein Stück Kulturgut und Wertschöpfung ist, sondern auch die Grundlage für die große Artenvielfalt in den Teichgebieten bildet, wurde und wird nach gangbaren Lösungen gesucht. Entschädigungsregelungen, die finanzielle Förderung von Zaunanlagen und die Beratung der betroffenen Teichwirte sind durchaus Erfolge. Am Ende kuriert man damit aber noch immer nur am Symptom, weil tatsächlich zufriedenstellende Lösungen ohne gezielte, lokale Eingriffe in die Ottervorkommen allein aus finanziellen Gründen – siehe Kosten für die Einzäunung – nicht flächendeckend umsetzbar sind. Der Versuch der Verwaltung, in der Oberpfalz einzelne Fischotter in Teichgebieten entnehmen zu lassen, wird derzeit von zwei anerkannten Naturschutzverbänden per Klage blockiert. Es bleibt deshalb abzuwarten, wie diese juristische Auseinandersetzung ausgeht.
Gibt es eine wachsende Zahl von Betriebsaufgaben?
Ja! Der Begriff Teichwirtschaft an sich sagt ja schon, dass es um das Erwirtschaften von letztlich finanziellen Erträgen geht. Anders sind die Teichgebiete als Betriebsanlagen, Landschaftselemente und wichtige Habitate für geschützte Arten nicht zu erhalten. Das erwirtschaften nachhaltiger Erträge gelingt inzwischen flächendeckend nicht mehr, so- fern die öffentliche Hand nicht mit finanziellen Beihilfen unterstützt. Kernproblem sind die insgesamt enormen Fischverluste durch Prädation. Dabei ist der Fischotter neben Kormoran, Silberreiher und vielen anderen Fischliebhabern nur einer von vielen Akteuren am und im Teich. In der Summe ist die Teichwirtschaft deshalb in- zwischen zur Fütterung von geschützten Arten mit Fisch verkommen. Dieser Um- stand, die entsprechende Frustration bei den Teichwirten und finanzielle Zwänge führten inzwischen zur Aufgabe einer Vielzahl von Teichen und Teichgebieten. Damit verschwinden neben der Wertschöpfung gerade im ländlichen Raum auch Biotope, auf die eine Vielzahl gefährdeter Tier und Pflanzenarten angewiesen sind. Wir erleben gerade, wie die zu unflexiblen Regelungen des europäischen Artenschutzrechts an ihrem eigenen Erfolg scheitern. Die ambitionierten Ziele der Biodiversitätsstrategie 2030, die von der EU-Kommission in die- sem Ausgegeben wurden, werden wir nicht nur in Deutschland schon allein wegen dem Verschwinden einer Vielzahl von Teichen/Teichgebieten und den dort lebenden, nach EU-Recht geschützten Arten, sicher verfehlen.
Wie ist die Stimmungslage in den Betrieben, die von Otterschäden betroffen sind?
Natürlich verstärkt die Problematik den ohnehin schon vorhandenen Frust auf die teils weltfremden Schutzbestimmungen der EU und die Verwaltungsstrukturen, die diese Bestimmungen umsetzen müssen. Zu sehen, wie der eigene und tatsächlich erhebliche Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt in Form der Teichbewirtschaftung ausgerechnet durch absolut dogmatische Schutzvorschriften aus Brüssel zunichte- gemacht wird, lässt die Menschen schlicht verzweifeln.
Was wäre konkret zu tun, um das Otterproblem so einzugrenzen, dass nachhaltige Fischerei und Aquakultur hier weiter eine Zukunftsperspektive haben?
Ursprung nicht nur des „Otterproblems“ ist ein Geburtsfehler der europäischen Artenschutzrichtlinien. Sowohl der Vogelschutz- als auch der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie fehlt der an sich zwingend notwendige Automatismus, mit dem sich der Schutzstatus für eine Art umgehend an die tatsächliche Gefährdungssituation dieser Art anpasst. Wo der Schutz erfolgreich war und damit sogar massive Schäden verbunden sind, muss der Schutzstatus regional angepasst und ggf. auch eine Regulierung der betreffenden Art möglich werden. Damit wäre nicht nur der Konflikt um den Fischotter augenblicklich entschärft. Auch bei Kormoran, Biber, Wolf oder Silberreiher würden sich so die nötigen Spielräume eröffnen, die derzeit von interessierten Kreisen mit Ver- weis auf die EU-Vorgaben juristisch blockiert werden. Zugleich würde so verhindert, dass wie bei der Reusenfischerei völlig überzogene Schutzvorschriften eine nach- haltige Befischung be- bzw. verhindern und zugleich die Akzeptanz für Maßnahmen des Artenschutzes ruinieren.
16.11.2020
VDBA Jahreshauptversammlung 2020
Mitteilung über die Jahreshauptversammlung des VDBA 2020
für das Jahr 2020 wurde durch das Präsidium beschlossen die jährliche Mitgliederversammlung als Webkonferenz abzuhalten. Alle Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen. Die schriftliche Einladung erfolgte bereits, fristgerecht.
hier der Link: VDBA – Einladung MV 2020
Einladung zur Mitgliederversammlung des VDBA
Tagungsform: Videokonferenz
Datum, Zeit: 03.12.2020 15:00-17:00 Uhr
Zugangsdaten werden rechtzeitig per e-mail mitgeteilt.
! technische Fragen zur Teilnahme können gerne im Vorfeld individuell nach Absprache erörtert werden!
Tagesordnung
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Feneis Präsident,
im Auftrag und Namen des gesamten Präsidiums
Sitz des Verbandes:
Verband der Deutschen Binnenfischerei und Aquakultur e. V.
Breslauer Str. 406, 90471 Nürnberg
Registergericht: Amtsgericht Nürnberg Vereinsregister-Nr.: 2552
Präsident: Bernhard Feneis, Vizepräsident: Peter Grimm Vizepräsident: Ronald Menzel
hier der Link: VDBA – Einladung MV 2020
Einladung zur Mitgliederversammlung des VDBA
Tagungsform: Videokonferenz
Datum, Zeit: 03.12.2020 15:00-17:00 Uhr
Zugangsdaten werden rechtzeitig per e-mail mitgeteilt.
! technische Fragen zur Teilnahme können gerne im Vorfeld individuell nach Absprache erörtert werden!
Tagesordnung
- Begrüßung und Gedenken an Dr. Wolfgang Stiehler
- Bestätigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 21.2019
- Bericht des Präsidenten
- Bericht der Kassenprüfer (Anlage 1)
- Feststellung Haushaltsabschluss 2019 (Anlage 2)
- Genehmigung Haushaltsvoranschlag 2020 (Anlage 3)
- Entlastung Vorstand und Kassenprüfer, Nachwahl von Torben Heese zum Stellvertreter Spartenleiter Karpfenteichwirtschaft und damit zum Präsidiumsmitglied sowie Nachwahl von Anna Klupp zum Mitglied der Spartenleitung Karpfenteichwirtschaft, soweit bis dato keine weiteren Kandidaturen vorliegen
- Vorstellung der Initiative Young Fishermen
- Diskussion und Festlegungen zu aktuellen Themen
- CORONA – Auswirkungen auf Bifi und Aquakultur
- Tiergesundheitsrecht
- Hochwasserschutz versus Teichdämme
- Kormoran, Otter, Biber
- Aal
- EMFAF
- Perspektive des VDBA
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Feneis Präsident,
im Auftrag und Namen des gesamten Präsidiums
Sitz des Verbandes:
Verband der Deutschen Binnenfischerei und Aquakultur e. V.
Breslauer Str. 406, 90471 Nürnberg
Registergericht: Amtsgericht Nürnberg Vereinsregister-Nr.: 2552
Präsident: Bernhard Feneis, Vizepräsident: Peter Grimm Vizepräsident: Ronald Menzel
30.10.2020
Lockdown, die Wissenschaft erklärt die Daten und die Maßnahmen
Dieser Text (erhalten am 29.10.20) zur Info, ohne Stellungnahme des für den Newsletter Verantwortlichen, B Feneis
Gemeinsame Erklärung der Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Präsidenten der Fraunhofer- Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina
Coronavirus-Pandemie: Es ist ernst
Zusammenfassung
Seit einigen Wochen ist ein dramatischer Anstieg der COVID-19-Fallzahlen in Europa zu verzeichnen (siehe Abbildungen 1 und 2). Am 21. Oktober 2020 hat die Anzahl neuer Infektionen innerhalb von 24 Stunden in Deutschland erstmals die Marke von 10.000 überstiegen. Dieser Anstieg ist aufgrund der hohen Fallzahlen an vielen Orten nicht mehr kontrollierbar. Dies kann eine beträchtliche Zahl von Behandlungsbedürftigen in den Krankenhäusern und einen starken Anstieg der Sterbezahlen zur Folge haben (siehe Abbildung 3). Eine solche Entwicklung findet in mehreren Nachbarstaaten bereits statt. Um einen ähnlichen Verlauf der Pandemie in Deutschland noch verhindern zu können, müssen jetzt klare Entscheidungen getroffen und schnell umgesetzt werden.
Aktuell kann die Ausbreitung des Virus in vielen Regionen von den Gesundheitsämtern aus Kapazitätsgründen nicht mehr adäquat nachverfolgt werden. Um diese Nachverfolgung wieder zu ermöglichen, müssen Kontakte, die potentiell zu einer Infektion führen, systematisch reduziert werden. Nur so werden eine Unterbrechung der Infektionsketten und ein Einhegen der Situation wieder möglich. Je früher und konsequenter alle Kontakte, die ohne die aktuell geltenden Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen stattfinden, eingeschränkt werden, desto kürzer können diese Beschränkungen sein (siehe Abbildung 5). Die hier getroffenen Aussagen basieren im Wesentlichen auf Modellrechnungen. Weitere Aspekte, insbesondere aus den Bereichen Virologie, Infektionsepidemiologie und Medizin, sollen in einer nachfolgenden Stellungnahme umfassender beleuchtet werden.

Abbildung 1: Zahl der täglich gemeldeten COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner in Deutschland und europäischen Ländern.

Abbildung 2: Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner und Woche in Deutschland seit dem 1. Oktober 2020 und Fortsetzung der Exponentialfunktion bis Ende November 2020. Die beobachtete Zahl der Fälle (Punkte) lässt sich durch eine einfache Exponentialfunktion beschreiben. Diese kann als grobe Näherung für ein Worst-Case-Szenario der Fallzahlen betrachtet werden, falls keine wirksamen Maßnahmen getroffen
Wenn die Gesundheitsämter überlastet sind, gerät die Pandemie außer Kontrolle.
Die Gesundheitsämter spielen in der Bekämpfung der Pandemie eine zentrale Rolle. Sie reagieren auf eine Infektion mit der Nachverfolgung von Kontakten der infizierten Person und der Isolation der Kontaktpersonen. Damit können Infektionsketten unterbrochen werden. Wenn die Fallzahlen oder die Anzahl der Kontakte infizierter Personen in einer Größenordnung liegen, bei der die Quarantäne von Kontaktpersonen vollständig gelingt, lässt sich das Infektionsgeschehen kontrollieren. Doch jeder infizierte Kontakt, der den Gesundheitsämtern entgeht, ist der Keim einer neuen Infektionskette, die sich dann der Kontrolle entzieht. Steigt die Zahl der unerkannten Virusträger weiter signifikant, dann geben immer mehr Personen das Virus weiter, ohne davon zu wissen, und treiben das exponentielle Wachstum der Infektionszahlen an. Eine Überlastung der Gesundheitsämter kann daher zu einer immer höheren Dunkelziffer und schließlich zu einem unkontrollierten exponentiellen Wachstum der Fallzahlen führen.
Die Gesundheitsämter sind bereits in vielen Kreisen überlastet.
Die Anzahl täglicher Neuinfektionen, ab der die Gesundheitsämter die Infektionsketten nicht mehr kontrollieren können – der sogenannte Kipppunkt –, ist in vielen Kreisen und kreisfreien Städten Deutschlands überschritten. Dies zeigt sich in der wachsenden Anzahl der Gesundheitsämter, die eine Überlastung melden. Sie können das Infektionsgeschehen nicht mehr eindämmen.
Die Fallzahlen müssen reduziert werden, bevor die Bettenauslastung in den Kliniken kritisch wird.
Im In- und Ausland ist zu beobachten, dass die unkontrollierte Ausbreitung des Virus in der jungen Bevölkerung auf die ältere übergreift und zu einer Überlastung des Gesundheitssystems zu führen droht. Dadurch werden zusätzliche Krankenhausbetten belegt und andere Erkrankte können nicht mehr adäquat behandelt werden. Dieser Trend kann sich in den nächsten Wochen bei unverändertem Verhalten fortsetzen (siehe Abbildung 3). Auf eine hohe Auslastung der Intensivbetten zu warten, bevor konsequente Maßnahmen gegen die Ausbreitung von SARS-CoV-2 umgesetzt werden, führt zu einer Krisensituation in der Krankenversorgung.

Abbildung 3: Erwartete Sterbezahlen (grün) bei unverändertem Verhalten, bei einer Kontaktreduktion auf die Hälfte ab dem 28.10. (orange) und bei einer Kontaktreduktion auf 25% ab dem 28.10. (blau).

Abbildung 4: Entwicklung der täglichen Neuinfektionen. Für die Beurteilung der täglichen Neuinfektionen in den kommenden Wochen wurden drei Szenarien angenommen. Die Fallzahlen steigen mit demselben R-Wert wie in den vergangenen Wochen (rot), alternativ wird für 3 Wochen eine wirksame Kontaktreduzierung ab 1. November (grün) oder ab 15. November (orange) durchgeführt. Die Datenpunkte sind RKI Meldedaten. Modell nach Dehning et al. arXiv:2004.01105
Eine unkontrollierte Ausbreitung in einzelnen Landkreisen und Städten gefährdet die Kontrolle in der ganzen Region.
Einen geringen Eintrag neuer Infektionen aus Nachbargemeinden können Gesundheitsämter normalerweise kompensieren. Breitet sich das Virus jedoch in zu vielen Landkreisen und Städten einer Region gleichzeitig unkontrolliert aus, werden unerkannte Träger das Virus vermehrt in Landkreise mit einer stabilen Infektionslage eintragen und sie destabilisieren. Dies spricht dafür, dass konzertierte Maßnahmen in betroffenen Landkreisen und Städten sowie den angrenzenden Landkreisen synchron durchgeführt werden müssen, wenn in einer Region zu viele Landkreise und Städte gleichzeitig eine unkontrollierte Ausbreitung haben.
Die Anzahl ungeschützter Kontakte zwischen Menschen und die konsequente Befolgung der AHAL-Regeln sind der Schlüssel zur Kontrolle.
Die wissenschaftliche Analyse des exponentiellen Anstiegs der COVID-19-Fallzahlen weist eindeutig darauf hin, dass es gegenwärtig ein Hauptinstrument gibt, um die Kontrolle über die Pandemie zurückzugewinnen: Die Anzahl der Kontakte zwischen Personen ohne adäquate Vorsichtsmaßnahmen muss konsequent reduziert werden (siehe Abbildungen 3 bis 5). Das Infektionspotenzial der zufälligen ungeschützten Kontakte muss durch Befolgung der AHAL- Regeln verringert werden.

Abbildung 5: Simulation der Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern und Woche in einer repräsentativen Großstadt in Deutschland, die Anfang Oktober 2020 mit niedrigen Fallzahlen startet. Die Zahl der Kontakte wird zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf ein Viertel reduziert. Es ist zu erkennen, dass die Dauer der Reduktion von Kontakten ohne Vorsichtsmaßnahmen, die benötigt wird, um den Schwellenwert von 35 (horizontale Line) zu erreichen, bei einer späten Kontaktreduktion unverhältnismäßig zunimmt. Der blau skizzierte Verlauf ist schon nicht mehr zu erreichen.
Es ist entscheidend, deutlich zu reagieren.
Eine Halbierung der Kontakte ohne Vorsichtsmaßnahmen eines jeden Einzelnen reicht laut wissenschaftlichen Simulationen des möglichen Pandemieverlaufs gegenwärtig nicht aus, um die Zahl von Neuinfizierten pro Woche zu senken. Die notwendige Reduktion von Kontakten ohne Vorsichtsmaßnahmen auf ein Viertel sollten in allen Bundesländern sowie in allen Landkreisen und Städten nach bundesweit einheitlichen Regeln durchgeführt werden.
Es ist entscheidend, schnell zu reagieren.
Je früher eine konsequente Reduktion von Kontakten ohne Vorsichtsmaßnahmen erfolgt, desto kürzer können diese andauern und desto weniger psychische, soziale und wirtschaftliche Kollateralschäden werden diese verursachen. Mit einer drastischen Reduktion der Kontakte ohne Vorsichtsmaßnahmen eines jeden Einzelnen auf ein Viertel kann die Pandemie eingedämmt werden (siehe Abbildung 5). Da sich Deutschland im Vergleich zu seinen Nachbarn in einer etwas früheren Phase des Anstiegs der Fallzahlen befindet, besteht jetzt noch die Chance, früher zu reagieren.
Es ist entscheidend, nachhaltig zu reagieren.
Das Ziel muss es sein, die Fallzahlen so weit zu senken, dass die Gesundheitsämter die Kontaktnachverfolgung wieder vollständig durchführen können. Sobald dies möglich ist, können die Beschränkungen vorsichtig gelockert werden, ohne dass unmittelbar eine erneute Pandemiewelle droht. Das muss aber bereits jetzt vorbereitet werden. Nach etwa 3 Wochen deutlicher Reduktion von Kontakten ohne Vorsichtsmaßnahmen wird es entscheidend sein, die nachfolgenden Maßnahmen bundesweit einheitlich und konsequent durchzusetzen, um die dann erreichte niedrige Fallzahl zu halten. Hierfür ist eine breit angelegte Kommunikations- Anstrengung notwendig, die in ganz Deutschland an allen öffentlichen Orten die AHA+L+A (Abstands-, Hygiene-und Alltagsmasken, Lüften, Corona-Warn-App)-Regeln unzweideutig und bundesweit einheitlich kommuniziert. Die Einhaltung dieser fundamentalen Regeln sollte besser kontrolliert und bei Nichtbeachtung konsequent geahndet werden. Das beinhaltet die stringente Einhaltung der Maskenpflicht sowie eine Kontrolle der Hygiene-Konzepte z.B. in Hotels, Restaurants und auf Veranstaltungen.
Darüber hinaus sollen als weitere Schutzmaßnahmen für den gesamten Winter gelten:
Partizipative Ansätze sollten besonders Personengruppen mit einbeziehen, von denen bekannt ist, dass sie sich seltener an die geltenden Regeln halten. Sie sollten in die Ausarbeitung der konkreten Umsetzungen der geltenden Regeln (z.B. am Arbeitsplatz, beim Sport, in der Kirche) mit einbezogen werden, um die Akzeptanz zu erhöhen.
Coronavirus-Pandemie: Es ist ernst
Zusammenfassung
Seit einigen Wochen ist ein dramatischer Anstieg der COVID-19-Fallzahlen in Europa zu verzeichnen (siehe Abbildungen 1 und 2). Am 21. Oktober 2020 hat die Anzahl neuer Infektionen innerhalb von 24 Stunden in Deutschland erstmals die Marke von 10.000 überstiegen. Dieser Anstieg ist aufgrund der hohen Fallzahlen an vielen Orten nicht mehr kontrollierbar. Dies kann eine beträchtliche Zahl von Behandlungsbedürftigen in den Krankenhäusern und einen starken Anstieg der Sterbezahlen zur Folge haben (siehe Abbildung 3). Eine solche Entwicklung findet in mehreren Nachbarstaaten bereits statt. Um einen ähnlichen Verlauf der Pandemie in Deutschland noch verhindern zu können, müssen jetzt klare Entscheidungen getroffen und schnell umgesetzt werden.
Aktuell kann die Ausbreitung des Virus in vielen Regionen von den Gesundheitsämtern aus Kapazitätsgründen nicht mehr adäquat nachverfolgt werden. Um diese Nachverfolgung wieder zu ermöglichen, müssen Kontakte, die potentiell zu einer Infektion führen, systematisch reduziert werden. Nur so werden eine Unterbrechung der Infektionsketten und ein Einhegen der Situation wieder möglich. Je früher und konsequenter alle Kontakte, die ohne die aktuell geltenden Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen stattfinden, eingeschränkt werden, desto kürzer können diese Beschränkungen sein (siehe Abbildung 5). Die hier getroffenen Aussagen basieren im Wesentlichen auf Modellrechnungen. Weitere Aspekte, insbesondere aus den Bereichen Virologie, Infektionsepidemiologie und Medizin, sollen in einer nachfolgenden Stellungnahme umfassender beleuchtet werden.

Abbildung 1: Zahl der täglich gemeldeten COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner in Deutschland und europäischen Ländern.

Abbildung 2: Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner und Woche in Deutschland seit dem 1. Oktober 2020 und Fortsetzung der Exponentialfunktion bis Ende November 2020. Die beobachtete Zahl der Fälle (Punkte) lässt sich durch eine einfache Exponentialfunktion beschreiben. Diese kann als grobe Näherung für ein Worst-Case-Szenario der Fallzahlen betrachtet werden, falls keine wirksamen Maßnahmen getroffen
Wenn die Gesundheitsämter überlastet sind, gerät die Pandemie außer Kontrolle.
Die Gesundheitsämter spielen in der Bekämpfung der Pandemie eine zentrale Rolle. Sie reagieren auf eine Infektion mit der Nachverfolgung von Kontakten der infizierten Person und der Isolation der Kontaktpersonen. Damit können Infektionsketten unterbrochen werden. Wenn die Fallzahlen oder die Anzahl der Kontakte infizierter Personen in einer Größenordnung liegen, bei der die Quarantäne von Kontaktpersonen vollständig gelingt, lässt sich das Infektionsgeschehen kontrollieren. Doch jeder infizierte Kontakt, der den Gesundheitsämtern entgeht, ist der Keim einer neuen Infektionskette, die sich dann der Kontrolle entzieht. Steigt die Zahl der unerkannten Virusträger weiter signifikant, dann geben immer mehr Personen das Virus weiter, ohne davon zu wissen, und treiben das exponentielle Wachstum der Infektionszahlen an. Eine Überlastung der Gesundheitsämter kann daher zu einer immer höheren Dunkelziffer und schließlich zu einem unkontrollierten exponentiellen Wachstum der Fallzahlen führen.
Die Gesundheitsämter sind bereits in vielen Kreisen überlastet.
Die Anzahl täglicher Neuinfektionen, ab der die Gesundheitsämter die Infektionsketten nicht mehr kontrollieren können – der sogenannte Kipppunkt –, ist in vielen Kreisen und kreisfreien Städten Deutschlands überschritten. Dies zeigt sich in der wachsenden Anzahl der Gesundheitsämter, die eine Überlastung melden. Sie können das Infektionsgeschehen nicht mehr eindämmen.
Die Fallzahlen müssen reduziert werden, bevor die Bettenauslastung in den Kliniken kritisch wird.
Im In- und Ausland ist zu beobachten, dass die unkontrollierte Ausbreitung des Virus in der jungen Bevölkerung auf die ältere übergreift und zu einer Überlastung des Gesundheitssystems zu führen droht. Dadurch werden zusätzliche Krankenhausbetten belegt und andere Erkrankte können nicht mehr adäquat behandelt werden. Dieser Trend kann sich in den nächsten Wochen bei unverändertem Verhalten fortsetzen (siehe Abbildung 3). Auf eine hohe Auslastung der Intensivbetten zu warten, bevor konsequente Maßnahmen gegen die Ausbreitung von SARS-CoV-2 umgesetzt werden, führt zu einer Krisensituation in der Krankenversorgung.

Abbildung 3: Erwartete Sterbezahlen (grün) bei unverändertem Verhalten, bei einer Kontaktreduktion auf die Hälfte ab dem 28.10. (orange) und bei einer Kontaktreduktion auf 25% ab dem 28.10. (blau).

Abbildung 4: Entwicklung der täglichen Neuinfektionen. Für die Beurteilung der täglichen Neuinfektionen in den kommenden Wochen wurden drei Szenarien angenommen. Die Fallzahlen steigen mit demselben R-Wert wie in den vergangenen Wochen (rot), alternativ wird für 3 Wochen eine wirksame Kontaktreduzierung ab 1. November (grün) oder ab 15. November (orange) durchgeführt. Die Datenpunkte sind RKI Meldedaten. Modell nach Dehning et al. arXiv:2004.01105
Eine unkontrollierte Ausbreitung in einzelnen Landkreisen und Städten gefährdet die Kontrolle in der ganzen Region.
Einen geringen Eintrag neuer Infektionen aus Nachbargemeinden können Gesundheitsämter normalerweise kompensieren. Breitet sich das Virus jedoch in zu vielen Landkreisen und Städten einer Region gleichzeitig unkontrolliert aus, werden unerkannte Träger das Virus vermehrt in Landkreise mit einer stabilen Infektionslage eintragen und sie destabilisieren. Dies spricht dafür, dass konzertierte Maßnahmen in betroffenen Landkreisen und Städten sowie den angrenzenden Landkreisen synchron durchgeführt werden müssen, wenn in einer Region zu viele Landkreise und Städte gleichzeitig eine unkontrollierte Ausbreitung haben.
Die Anzahl ungeschützter Kontakte zwischen Menschen und die konsequente Befolgung der AHAL-Regeln sind der Schlüssel zur Kontrolle.
Die wissenschaftliche Analyse des exponentiellen Anstiegs der COVID-19-Fallzahlen weist eindeutig darauf hin, dass es gegenwärtig ein Hauptinstrument gibt, um die Kontrolle über die Pandemie zurückzugewinnen: Die Anzahl der Kontakte zwischen Personen ohne adäquate Vorsichtsmaßnahmen muss konsequent reduziert werden (siehe Abbildungen 3 bis 5). Das Infektionspotenzial der zufälligen ungeschützten Kontakte muss durch Befolgung der AHAL- Regeln verringert werden.

Abbildung 5: Simulation der Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern und Woche in einer repräsentativen Großstadt in Deutschland, die Anfang Oktober 2020 mit niedrigen Fallzahlen startet. Die Zahl der Kontakte wird zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf ein Viertel reduziert. Es ist zu erkennen, dass die Dauer der Reduktion von Kontakten ohne Vorsichtsmaßnahmen, die benötigt wird, um den Schwellenwert von 35 (horizontale Line) zu erreichen, bei einer späten Kontaktreduktion unverhältnismäßig zunimmt. Der blau skizzierte Verlauf ist schon nicht mehr zu erreichen.
Es ist entscheidend, deutlich zu reagieren.
Eine Halbierung der Kontakte ohne Vorsichtsmaßnahmen eines jeden Einzelnen reicht laut wissenschaftlichen Simulationen des möglichen Pandemieverlaufs gegenwärtig nicht aus, um die Zahl von Neuinfizierten pro Woche zu senken. Die notwendige Reduktion von Kontakten ohne Vorsichtsmaßnahmen auf ein Viertel sollten in allen Bundesländern sowie in allen Landkreisen und Städten nach bundesweit einheitlichen Regeln durchgeführt werden.
Es ist entscheidend, schnell zu reagieren.
Je früher eine konsequente Reduktion von Kontakten ohne Vorsichtsmaßnahmen erfolgt, desto kürzer können diese andauern und desto weniger psychische, soziale und wirtschaftliche Kollateralschäden werden diese verursachen. Mit einer drastischen Reduktion der Kontakte ohne Vorsichtsmaßnahmen eines jeden Einzelnen auf ein Viertel kann die Pandemie eingedämmt werden (siehe Abbildung 5). Da sich Deutschland im Vergleich zu seinen Nachbarn in einer etwas früheren Phase des Anstiegs der Fallzahlen befindet, besteht jetzt noch die Chance, früher zu reagieren.
Es ist entscheidend, nachhaltig zu reagieren.
Das Ziel muss es sein, die Fallzahlen so weit zu senken, dass die Gesundheitsämter die Kontaktnachverfolgung wieder vollständig durchführen können. Sobald dies möglich ist, können die Beschränkungen vorsichtig gelockert werden, ohne dass unmittelbar eine erneute Pandemiewelle droht. Das muss aber bereits jetzt vorbereitet werden. Nach etwa 3 Wochen deutlicher Reduktion von Kontakten ohne Vorsichtsmaßnahmen wird es entscheidend sein, die nachfolgenden Maßnahmen bundesweit einheitlich und konsequent durchzusetzen, um die dann erreichte niedrige Fallzahl zu halten. Hierfür ist eine breit angelegte Kommunikations- Anstrengung notwendig, die in ganz Deutschland an allen öffentlichen Orten die AHA+L+A (Abstands-, Hygiene-und Alltagsmasken, Lüften, Corona-Warn-App)-Regeln unzweideutig und bundesweit einheitlich kommuniziert. Die Einhaltung dieser fundamentalen Regeln sollte besser kontrolliert und bei Nichtbeachtung konsequent geahndet werden. Das beinhaltet die stringente Einhaltung der Maskenpflicht sowie eine Kontrolle der Hygiene-Konzepte z.B. in Hotels, Restaurants und auf Veranstaltungen.
Darüber hinaus sollen als weitere Schutzmaßnahmen für den gesamten Winter gelten:
- konsequenter Schutz von Risikogruppen durch gezielte Maßnahmen,
- eine verbesserte Kommunikation der Vorsichtsmaßnahmen in der Bevölkerung mit konkreten Verhaltensempfehlungen und Beispielen,
- das konsequente Tragen von Masken auch in Schulen,
- die konsequente Nutzung der Corona-Warn-App,
- im privaten Bereich Feiern zu vermeiden und Kontakte weiterhin möglichst einzuschränken sowie privaten Treffen im Freien (z.B. gemeinsame Spaziergänge) den Vorzug vor Treffen in geschlossenen Räumen zu geben,
- die Schärfung und Kontrolle von Hygiene-Konzepten.
Partizipative Ansätze sollten besonders Personengruppen mit einbeziehen, von denen bekannt ist, dass sie sich seltener an die geltenden Regeln halten. Sie sollten in die Ausarbeitung der konkreten Umsetzungen der geltenden Regeln (z.B. am Arbeitsplatz, beim Sport, in der Kirche) mit einbezogen werden, um die Akzeptanz zu erhöhen.
27.10.2020
GD Sante EU: Veröffentlichung zum Thema „Fishwelfare“
Bei der GD Sante ist nun eine Broschüre veröffentlicht zum Thema Fishwelfare.
Bei der GD Sante ist nun eine Broschüre veröffentlicht zum Thema Fishwelfare. Im Rahmen des großen Projektes Animalwelfare hatte sich eine Gruppe auf meine Initiative hin zusammengefunden, die sich dem Thema „Wohlbefinden, Fisch“ widmete. Für die Fischzüchter ist das leider nicht so gelaufen wie ursprünglich beabsichtigt. Eine Kommunikation mit der GD Sante wurde generell abgelehnt. Auch wurden wir weder durch Sachmittel noch finanziell unterstützt.
Die GD Sante hat sich einem Dialog bezüglich des Leidens unserer Fische durch Prädatoren völlig verweigert, und die Aufnahme dieses Themas in die Publikation strikt abgelehnt. (siehe Titelbild)
Viel mehr wollte man publikumswirksam zeigen, dass die DG Sante den Tierschutz im Focus hat. Also hat man das Einfachste gemacht was möglich war, man hat versucht der Branche zu sagen, wie Fische transportiert und geschlachtet werden sollen. Das teils lebenslange Leiden durch Prädatoren gehört jedenfalls in der EU nicht zu den Belangen des Tierschutzes!
Es wurde von uns dann wenigstens soviel Einfluß genommen, dass nicht ausschließlich branchenfremde Gruppierungen die für uns geltenden Richtlinien bestimmen. Herausgekommen ist eine Handlungsanweisung für Europäische Aquakulturbetriebe, mit dem Schwerpunkt auf Wasserparameter und Transportbedingungen.
Hier der Text zum Download
Für die Überlassung der Booklets zum Fisch-Transport und –Schlachtung als Grundlage für den Teil „Süßwasserfische“, Dank an Präsident Jakob Opperer und Dr. Helmut Wedekind, Bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Fischerei Starnberg,
Dank für die Überlasssung des Titelbildes an Alexander Horn
Die GD Sante hat sich einem Dialog bezüglich des Leidens unserer Fische durch Prädatoren völlig verweigert, und die Aufnahme dieses Themas in die Publikation strikt abgelehnt. (siehe Titelbild)
Viel mehr wollte man publikumswirksam zeigen, dass die DG Sante den Tierschutz im Focus hat. Also hat man das Einfachste gemacht was möglich war, man hat versucht der Branche zu sagen, wie Fische transportiert und geschlachtet werden sollen. Das teils lebenslange Leiden durch Prädatoren gehört jedenfalls in der EU nicht zu den Belangen des Tierschutzes!
Es wurde von uns dann wenigstens soviel Einfluß genommen, dass nicht ausschließlich branchenfremde Gruppierungen die für uns geltenden Richtlinien bestimmen. Herausgekommen ist eine Handlungsanweisung für Europäische Aquakulturbetriebe, mit dem Schwerpunkt auf Wasserparameter und Transportbedingungen.
Hier der Text zum Download
Für die Überlassung der Booklets zum Fisch-Transport und –Schlachtung als Grundlage für den Teil „Süßwasserfische“, Dank an Präsident Jakob Opperer und Dr. Helmut Wedekind, Bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Fischerei Starnberg,
Dank für die Überlasssung des Titelbildes an Alexander Horn
24.10.2020
FEAP Positionspapier zum Thema Fishwelfare
Nicht nur in Deutschland wird Fish Welfare heiß diskutiert.
Der europäische Verband der Aquakuturproduzenten FEAP, positioniert sich gegenüber der DG MARE und der DG Sante zum Thema Fishwelfare.
Als Vizepräsident der FEAP, möchte ich hier den für ganz Europa von uns formulierten Text vorstellen:
The FEAP is the united voice of the European aquaculture producers,
representing 22 members out of 21 countries. FEAP represents a wide range of farmed species that include Atlantic salmon, rainbow trout, seabass, seabream, carp, catfish, turbot, cod, sturgeon and meagre.
The FEAP strives to assure the welfare of fish farmed in Europe. Fish farmers are the owners of their fish stocks and are responsible for them.
FEAP’s position:
Als Vizepräsident der FEAP, möchte ich hier den für ganz Europa von uns formulierten Text vorstellen:
The FEAP is the united voice of the European aquaculture producers,
representing 22 members out of 21 countries. FEAP represents a wide range of farmed species that include Atlantic salmon, rainbow trout, seabass, seabream, carp, catfish, turbot, cod, sturgeon and meagre.
The FEAP strives to assure the welfare of fish farmed in Europe. Fish farmers are the owners of their fish stocks and are responsible for them.
FEAP’s position:
- Fish are not a single species but many and with considerable biological differences between them, including welfare needs. Furthermore, fish farming in Europe is a very diverse activity taking place both in marine and fresh waters and using different production systems such as tanks, ponds and sea
- FEAP promotes a holistic approach to fish welfare in which specific welfare issues must be considered alongside the limitations of the physical farming environment, workers safety, environmental protection, product quality and economic
- European fish farmers follow rules and regulations on health and animal welfare that apply to fish.
- FEAP understands that Good Practice at farm level is key to ensuring the adequate welfare of fish and, for this reason, promotes their uptake within the
- The farming of fish is a young activity when compared to other livestock production. For this reason, even today important gaps exist in scientific knowledge on this matter. Furthermore, reference centres such as those used in the agriculture sector should be created for the aquaculture sector. FEAP recommends the promotion of further scientific research on fish welfare, in particular welfare
- FEAP considers that when addressing fish welfare, the whole life cycle of the fish has to be addressed.
- FEAP recognises the importance of adequate training for fish farm workers on this
- FEAP wishes to highlight that fish welfare should not contribute towards the un-level playing field with respect to other fish products, both imported into Europe or caught by fishing fleets.
- FEAP understands the relevance of communication to make society aware of how European farmed fish are treated. FEAP is concerned with the misleading communication actions on fish welfare which have recently appeared in the media.
24.10.2020
Leitlinien zur Abfischung unter „Corona Bedingungen“, (Bay.)
Merkblatt für das Abfischen und den Verkauf von Fischen
Merkblatt für das Abfischen und den Verkauf von Fischen in Zeiten, da große Unsicherheit besteht wer in welch großen Gruppen sich treffen, oder arbeiten darf.


19.10.2020
Die Aquakultur im Context allgemeiner politischen Herausforderungen
Die Folien eines Vortrags von Lorella de la Cruz, einer Mitarbeiterin der DG MARE:
Diese Themen werden zur Zeit in Brüssel, z.B. im AAC, diskutiert. Einschätzungen und Positionen der FEAP und von COPA_Cogeca berichte ich nach der internen Diskussion!














Der Verband gliedert sich in folgende Sparten, vertreten durch:
Präsidium
Präsident: Bernhard Feneis
Vizepräsident: Peter Grimm und Ronald Menzel
Weiterhin:
Stefan Hofer
Sabine Schwarten
Torben Heese
Vizepräsident: Peter Grimm und Ronald Menzel
Weiterhin:
Stefan Hofer
Sabine Schwarten
Torben Heese
Forellenzucht
Spartenleiter: Peter Grimm
Stellvertreter: Stephan Hofer
weitere Mitglieder:
Elmar Mohnen
Markus Lichtenecker
Torsten Uhthoff
Alexander Tautenhahn
Stellvertreter: Stephan Hofer
weitere Mitglieder:
Elmar Mohnen
Markus Lichtenecker
Torsten Uhthoff
Alexander Tautenhahn
Karpfenteichwirtschaft
Spartenleiter: Bernhard Feneis
Stellvertreter: Torben Heese
weitere Mitglieder:
Gerd Michaelis
Gunnar Reese
Alfred Stier
Stellvertreter: Torben Heese
weitere Mitglieder:
Gerd Michaelis
Gunnar Reese
Alfred Stier
Fluss- und Seenfischerei
Spartenleiter: Ronald Menzel
Stellvertreterin: Sabine Schwarten
weitere Mitglieder:
Carsten Brauer
Florian Lex
Martin Bork
Martin Boesenecker
Stellvertreterin: Sabine Schwarten
weitere Mitglieder:
Carsten Brauer
Florian Lex
Martin Bork
Martin Boesenecker
Spartenleiterin: Anna Klupp
Stellvertreterin: Isabel Schwegel
Weiterhin:
Karl Bissa
Gero Weinhardt
Martin Weierich
Stellvertreterin: Isabel Schwegel
Weiterhin:
Karl Bissa
Gero Weinhardt
Martin Weierich




