Suche
Suche
Start
Fischotterausgleich in Bayern bis zu 100%
Verordnung zur Entnahme von Fischottern in Bayern außer Kraft gesetzt
Staatliche Beihilfen: Kommission bittet um Stellungnahmen zur vorgeschlagenen Überarbeitung der EU-Beihilfevorschriften für die Land- und Forstwirtsch
Verband der deutschen Binnenfischerei und Aquakultur e. v.
Aufgabe und Zweck des VDBA ist die nationale, gemeinschaftliche und internationale Vertretung aller Belange der deutschen Fischzucht, Fischhaltung sowie der Seen- und Flussfischerei. Der VDBA setzt sich für den Natur-, Gewässer- und Tierschutz ein. Er fördert die Union der Berufsfischer und Angler und ist Mitglied im Deutschen Fischerei-Verband e. V..
Verband der deutschen Binnenfischerei und Aquakultur e. v.
Aufgabe und Zweck des VDBA ist die nationale, gemeinschaftliche und internationale Vertretung aller Belange der deutschen Fischzucht, Fischhaltung sowie der Seen- und Flussfischerei. Der VDBA setzt sich für den Natur-, Gewässer- und Tierschutz ein. Er fördert die Union der Berufsfischer und Angler und ist Mitglied im Deutschen Fischerei-Verband e. V..
Verband der deutschen Binnenfischerei und Aquakultur e. v.
Aufgabe und Zweck des VDBA ist die nationale, gemeinschaftliche und internationale Vertretung aller Belange der deutschen Fischzucht, Fischhaltung sowie der Seen- und Flussfischerei. Der VDBA setzt sich für den Natur-, Gewässer- und Tierschutz ein. Er fördert die Union der Berufsfischer und Angler und ist Mitglied im Deutschen Fischerei-Verband e. V..
News
Alle Kategorien
26.01.2026
Auswirkungen der Kormoranprädation auf die Fischerei und Aquakultur in der EU
Aktuelle Übersicht zur Kormoranprädation in der EU
Briefing vom 20.01.2026
Der Kormoran hat erhebliche und weitreichende Auswirkungen auf Fischbestände und Aquakulturanlagen. Aufgrund seiner Prädationstätigkeit wurde der Kormoran im 19. und frühen 20. Jahrhundert stark verfolgt, steht aber seit Inkrafttreten der EU-Vogelschutzrichtlinie im Jahr 1979 unter Schutz. Seine Population hat sich seitdem deutlich erholt. Obwohl die Jagd auf den Vogel verboten ist, erlaubt die Vogelschutzrichtlinie Ausnahmeregelungen, um schwere Schäden an Wildfischbeständen und Fischzuchten zu verhindern. Diese Ausnahmeregelungen werden von den Mitgliedstaaten in sehr unterschiedlicher Weise genutzt.
Das Europäische Parlament forderte 2008 die Annahme eines europäischen Kormoranmanagementplans, um die zunehmenden Auswirkungen der Kormorane auf Fischbestände, Fischerei und Aquakultur zu minimieren. Diese Forderung wurde in den Entschließungen des Parlaments zur Aquakultur von 2018 und 2022 bekräftigt. Auch auf den Ratssitzungen im September und Oktober 2025 forderten mehrere Mitgliedstaaten die Europäische Kommission nachdrücklich auf, das EU-weite Management der Kormoranpopulationen zu koordinieren.
Im Anschluss an die jüngsten Gespräche führte die Kommission im Oktober 2025 einen strukturierten Dialog mit den Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang veröffentlichte die Kommission aktualisierte Leitlinien zur Anwendung von Ausnahmeregelungen gemäß der Vogelschutzrichtlinie. Im November 2025 veröffentlichte die Europäische Binnenfischerei- und Aquakultur-Beratungskommission, ein zwischenstaatliches Beratungsgremium für Fischereifragen, ihren endgültigen Rahmen für einen Managementplan im Rahmen eines von der EU kofinanzierten Projekts.
Ziel dieser Initiative ist es, den günstigen Erhaltungszustand des Kormorans zu erhalten und gleichzeitig Fischarten und Aquakulturanlagen zu schützen.
Hierzu ist nun ein umfagnreicher „Briefing“-Artikel in Englischer Sprache erschienen.
(„Briefing“-Artikel bieten forschungsbasierte Handlungsempfehlungen zu drängenden wirtschaftlichen Herausforderungen und sind in einer für Laien verständlichen Sprache verfasst. Sie sollen so kurz wie möglich sein, aber dennoch ausreichend ausführlich, um ein politisches Problem eingehend zu beleuchten)
Der Kormoran hat erhebliche und weitreichende Auswirkungen auf Fischbestände und Aquakulturanlagen. Aufgrund seiner Prädationstätigkeit wurde der Kormoran im 19. und frühen 20. Jahrhundert stark verfolgt, steht aber seit Inkrafttreten der EU-Vogelschutzrichtlinie im Jahr 1979 unter Schutz. Seine Population hat sich seitdem deutlich erholt. Obwohl die Jagd auf den Vogel verboten ist, erlaubt die Vogelschutzrichtlinie Ausnahmeregelungen, um schwere Schäden an Wildfischbeständen und Fischzuchten zu verhindern. Diese Ausnahmeregelungen werden von den Mitgliedstaaten in sehr unterschiedlicher Weise genutzt.
Das Europäische Parlament forderte 2008 die Annahme eines europäischen Kormoranmanagementplans, um die zunehmenden Auswirkungen der Kormorane auf Fischbestände, Fischerei und Aquakultur zu minimieren. Diese Forderung wurde in den Entschließungen des Parlaments zur Aquakultur von 2018 und 2022 bekräftigt. Auch auf den Ratssitzungen im September und Oktober 2025 forderten mehrere Mitgliedstaaten die Europäische Kommission nachdrücklich auf, das EU-weite Management der Kormoranpopulationen zu koordinieren.
Im Anschluss an die jüngsten Gespräche führte die Kommission im Oktober 2025 einen strukturierten Dialog mit den Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang veröffentlichte die Kommission aktualisierte Leitlinien zur Anwendung von Ausnahmeregelungen gemäß der Vogelschutzrichtlinie. Im November 2025 veröffentlichte die Europäische Binnenfischerei- und Aquakultur-Beratungskommission, ein zwischenstaatliches Beratungsgremium für Fischereifragen, ihren endgültigen Rahmen für einen Managementplan im Rahmen eines von der EU kofinanzierten Projekts.
Ziel dieser Initiative ist es, den günstigen Erhaltungszustand des Kormorans zu erhalten und gleichzeitig Fischarten und Aquakulturanlagen zu schützen.
Hierzu ist nun ein umfagnreicher „Briefing“-Artikel in Englischer Sprache erschienen.
(„Briefing“-Artikel bieten forschungsbasierte Handlungsempfehlungen zu drängenden wirtschaftlichen Herausforderungen und sind in einer für Laien verständlichen Sprache verfasst. Sie sollen so kurz wie möglich sein, aber dennoch ausreichend ausführlich, um ein politisches Problem eingehend zu beleuchten)
18.01.2026
Berliner Agrarministerkonferenz 2026: Ein Ort für Brücken, nicht für Gräben
Ministerinnen und Minister aus rund 60 Staaten wollen effizientere Wassernutzung in der Landwirtschaft fördern
Unter Vorsitz des Bundesministers für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Alois Rainer, fand heute die 18. Berliner Agrarministerkonferenz mit Agrarministerinnen und Agrarministern aus 61 Staaten sowie Vertreterinnen und Vertretern von 14 internationalen Organisationen statt. In ihrer Abschlusserklärung betonten die Ministerinnen und Minister, dass die Landwirtschaft auf ausreichend Wasser angewiesen ist, um Lebensmittel zu produzieren. Landwirtschaft spielt damit eine Schlüsselrolle für die globale Ernährungssicherheit. Zugleich machten die Agrarminister deutlich, dass die Landwirtschaft als einer der größten Wassernutzer ein zentraler Teil der Lösung bei der Bewältigung von Wasserknappheit ist. Sie kann entscheidend zu einer nachhaltigen Wassernutzung beitragen und wirksame Lösungen für eine globale Wasserresilienz liefern.
Dazu sagt Bundesminister Rainer: „Wasser entscheidet über Ernten, Ernten entscheiden über Ernährung und eine gesicherte Ernährung entscheidet über unsere Zukunft. Uns Agrarministerinnen und Agrarminister eint ein Auftrag: die Produktivität der Land- und Ernährungswirtschaft zu stärken, Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und damit die Einkommen der Höfe zu stabilisieren. Und dabei ist klar: Landwirtschaft braucht Wasser.
Ich freue mich, dass heute von Berlin das klare Bekenntnis ausgeht, dass die Landwirtschaft nicht das Problem, sondern ein zentraler Teil der Lösung für eine nachhaltige Wassernutzung ist. Darauf haben wir uns in unserer Abschlusserklärung verständigt. Diese Abschlusserklärung ist der Ausdruck unseres gemeinsamen Willens, Verantwortung zu übernehmen. Wir bekennen uns dazu, eine effizientere Wassernutzung in der Landwirtschaft zu fördern, etwa durch präzise Bewässerung, Wassereinsparung, besseren Bodenschutz und die Reduzierung von Lebensmittelverlusten. Das zeigt, dass die Agrarministerkonferenz ein Ort für Brücken ist, nicht für Gräben.“
Ich freue mich, dass heute von Berlin das klare Bekenntnis ausgeht, dass die Landwirtschaft nicht das Problem, sondern ein zentraler Teil der Lösung für eine nachhaltige Wassernutzung ist. Darauf haben wir uns in unserer Abschlusserklärung verständigt. Diese Abschlusserklärung ist der Ausdruck unseres gemeinsamen Willens, Verantwortung zu übernehmen. Wir bekennen uns dazu, eine effizientere Wassernutzung in der Landwirtschaft zu fördern, etwa durch präzise Bewässerung, Wassereinsparung, besseren Bodenschutz und die Reduzierung von Lebensmittelverlusten. Das zeigt, dass die Agrarministerkonferenz ein Ort für Brücken ist, nicht für Gräben.“
Die Ministerinnen und Minister haben zudem gefordert, die Stimme der Landwirtschaft im Vorfeld der UN-Wasserkonferenz 2026 zu stärken und den Sektor in der globalen Wasserpolitik einzubeziehen.
Die wichtigsten Punkte der Abschlusserklärung für die Fischerei sind:
2. Wir unterstreichen, dass Wasser für alles Leben auf der Erde, für unsere Volkswirtschaften und für unsere Ernährungssysteme unverzichtbar ist. Unsere Landwirtinnen und Landwirte und Fischerinnen und Fischer sind auf Wasser angewiesen, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Wasserstress ist jedoch eine der größten Bedrohungen des 21. Jahrhunderts, unter der mehr als zwei Milliarden Menschen leiden. … Landwirtschaft, Fischerei und Aquakultur sind weltweit stark von wachsender Wassernutzungskonkurrenz betroffen, was es immer schwieriger macht, ihre Rolle bei der Gewährleistung von Ernährungssicherheit und -qualität und der schrittweisen Verwirklichung des Rechts auf angemessene Nahrung zu erfüllen. …
Blaue Bioökonomie stärken
13. In Übereinstimmung mit dem GFFA-Kommuniqué 2025 zur Bioökonomie betonen wir die zentrale Rolle einer nachhaltigen blauen Bioökonomie für alle Branchen und Sektoren, die mit Ozeanen, Meeren, Küsten und Seen und ihren lebenden Ressourcen in Verbindung stehen. Wir erkennen darüber hinaus das Potenzial der blauen Bioökonomie an, die Ernährungssicherheit zu steigern und gleichzeitig die Einkommensdiversifizierung für lokale Gemeinschaften in küstennahen und ländlichen Gebieten zu stärken und traditionelles Wissen zu schützen. Wir verpflichten uns zu einer effektiven Erhaltung, Bewirtschaftung, Wiederherstellung und nachhaltigen Nutzung von lebenden aquatischen Ressourcen und Wasser. Dazu gehört die Förderung nachhaltiger Fischerei und Aquakultur sowie die Verbesserung der Nutzbarmachung, Verarbeitung und Wertschöpfung von Produkten aus aquatischen Ressourcen im Einklang mit den FAO-Leitlinien für nachhaltige Aquakultur.
16. Wir sehen die Notwendigkeit, Innovationen, Entwicklung und inklusive Marktintegration in Bezug auf nachhaltig produzierte aquatische Biomasse, insbesondere vielversprechende, jedoch derzeit unzureichend genutzte Ressourcen wie Algen und Restrohstoffe aus Fischerei und Aquakultur, zu unterstützen. Wir heben die Notwendigkeit hervor, soziales Bewusstsein und Akzeptanz von neuen Produkten der blauen Bioökonomie zu steigern.
20. Wir erkennen an, dass der Zugang zu Wasser für die Nahrungsmittelproduktion von zentraler Bedeutung ist. Wir nehmen Kenntnis vom „Globalen Dialog zu Nutzungs- und Besitzrechten an Wasser“5 der FAO, der alle FAO-Mitglieder ermutigt, sich der politischen Initiative anzuschließen, um einen kontextspezifischen, gleichberechtigten, zeitgerechten und sicheren Zugang zu Wasserressourcen zu unterstützen.
Internationale Wasser Governance stärken
22. Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordination bei Wasser bei gleichzeitiger Achtung der nationalen Souveränität ist entscheidend für eine effektive Bekämpfung von Wasserstress. Daher sind wir bestrebt, zu größerer Bewusstheit, Kohärenz und Effektivität der Wasser Governance im VN-System und darüber hinaus beizutragen. Damit werden wir die Stimme der Landwirtschaft, der Fischerei und der Aquakultur bei wasserpolitischen Entscheidungen stärken. Wir unterstreichen, dass diese zentralen Akteure Fachwissen einbringen und den Weg zu globalen Lösungen weisen.
28. Angesichts der dringenden Notwendigkeit, Wassersicherheit und Wasserresilienz zu steigern, und im Vorfeld der VN-Wasserkonferenz 2026 und darüber hinaus rufen wir die internationale Gemeinschaft auf:
- die Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur als zentrale Sektoren in die Entscheidungsfindung innerhalb der Wasserpolitik einzubinden; …
20.12.2025
EU-Fischmarktbericht 2025 veröffentlicht
Die Europäische Marktbeobachtungsstelle für Fischerei (EUMOFA) hat die 2025 Ausgabe des EU-Fischmarktberichts veröffentlicht, der die neuesten Trends im europäischen Fischerei- und Aquakulturmarkt aufzeigt. Basierend auf Daten bis Anfang 2025 belegt der Bericht, dass der Markt volatilen Preisen, dynamischen globalen Angebotsbedingungen und einem sich wandelnden Verbraucherverhalten ausgesetzt war.
15.12.2025
Umsetzung der EU Kontroll-VO zur Rückverfolgbarkeit von Fisch und Fischerzeugnissen
Europäischer Gesetzgeber definiert Basisstandard und schafft Rechtssicherheit für die Unternehmen
Die überarbeitete europäische Fischereikontrollverordnung bringt ab dem 10.01.2026 neue gesetzliche Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit von Fischerei und Aquakulturerzeugnissen (für frische, gefrorene und geräucherte Produkte) in der Union. Bisher wurden wichtige Grundlagen zur praktischen Umsetzung dieser Vorgaben vom europäischen Gesetzgeber nicht geregelt. Nach wiederholter Eingabe des Bundesverbandes und der europäischen Partnerverbände hat die Europäische Kommission gestern wichtige Eckpunkte erläutert. Damit wird größerer Schaden abgewendet und Rechtssicherheit für die Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette vom Erzeuger bis zum Handel geschaffen.
Die Unternehmen erhalten die Entwarnung, dass sie ihre bisherigen Verfahren zur Rückverfolgbarkeit nicht fundamental umstellen müssen.
Auch der VDBA begrüßt diese Klarstellung zur Umsetzung der geänderten Fischereikontrollverordnung.
Der Bundesverband der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V. fasst dies in seiner PM wie folgt zusammen:
Informationsschreiben EU-KOM im englischen Original als PDF
Dr. Stefan Meyer, Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V., hat die Entwicklungen dieses Regelwerks in Berlin und Brüssel intensiv begleitet und merkt hierzu an: „Mit dem Informationsblatt wird das Grundprinzip der Rückverfolgbarkeit – die Eigenverantwortung der Unternehmen auf ihrer jeweiligen Stufe der Lieferkette – klar gestärkt. Die nun vorliegenden Klarstellungen schaffen Rechtssicherheit für die Betriebe und geben ihnen die notwendige Orientierung, um die Vorgaben sachgerecht und praxistauglich umzusetzen.“
Die Unternehmen erhalten die Entwarnung, dass sie ihre bisherigen Verfahren zur Rückverfolgbarkeit nicht fundamental umstellen müssen.
Auch der VDBA begrüßt diese Klarstellung zur Umsetzung der geänderten Fischereikontrollverordnung.
Der Bundesverband der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V. fasst dies in seiner PM wie folgt zusammen:
- Losfassung beginnt am Ursprung: Die Losbildung beginnt im Ursprung, d. h. bei Fischerei und Aquakultur. Damit sind Herkunft und erste Zusammenstellung der Ware miteinander verbunden und bleiben durchgängig nachvollziehbar. Auf Grundlage dieser Informationen können die nachfolgenden Lieferkettenpartner Lose nach ihren Bedürfnissen teilen, mischen und zusammenfassen. Die grundlegenden Losinformationen bleiben davon unberührt.
- Flexible digitale Formate: Die digitale Bereitstellung der Losinformationen kann in verschiedenen gängigen Formaten erfolgen – zum Beispiel per E-Mail, als elektronische Dateien (wie PDF, XML oder CSV), über Online-Plattformen oder jedes andere elektronische System, das in der Lage ist, Informationen auf digitale, papierlose Weise zu übermitteln. Unternehmen wählen das für ihren Betrieb praktikable Format, solange die Mindestangaben vollständig und nachvollziehbar übermittelt werden. Damit können auch bereits etablierte Dokumentenformate, z. B. Lieferscheine, die Vorgaben erfüllen, wenn sie auf digitalem Weg übermittelt werden und die entsprechenden Losinformationen enthalten.
- „Ein Schritt vor, ein Schritt zurück“: Die Informationen werden entlang der Lieferkette von Glied zu Glied weitergegeben. Eine übergeordnete Weitergabe, branchenweite Interoperabilitätspflichten oder die verbindliche Nutzung von Drittanbieter Lösungen zur Rückverfolgbarkeit sind nicht gefordert. Entscheidend ist die sichere Übermittlung der Daten an den jeweiligen direkten Geschäftspartner und, auf Verlangen an die zuständige Behörde.
Informationsschreiben EU-KOM im englischen Original als PDF
Dr. Stefan Meyer, Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V., hat die Entwicklungen dieses Regelwerks in Berlin und Brüssel intensiv begleitet und merkt hierzu an: „Mit dem Informationsblatt wird das Grundprinzip der Rückverfolgbarkeit – die Eigenverantwortung der Unternehmen auf ihrer jeweiligen Stufe der Lieferkette – klar gestärkt. Die nun vorliegenden Klarstellungen schaffen Rechtssicherheit für die Betriebe und geben ihnen die notwendige Orientierung, um die Vorgaben sachgerecht und praxistauglich umzusetzen.“
Wichtige branchenrelevante Webseiten
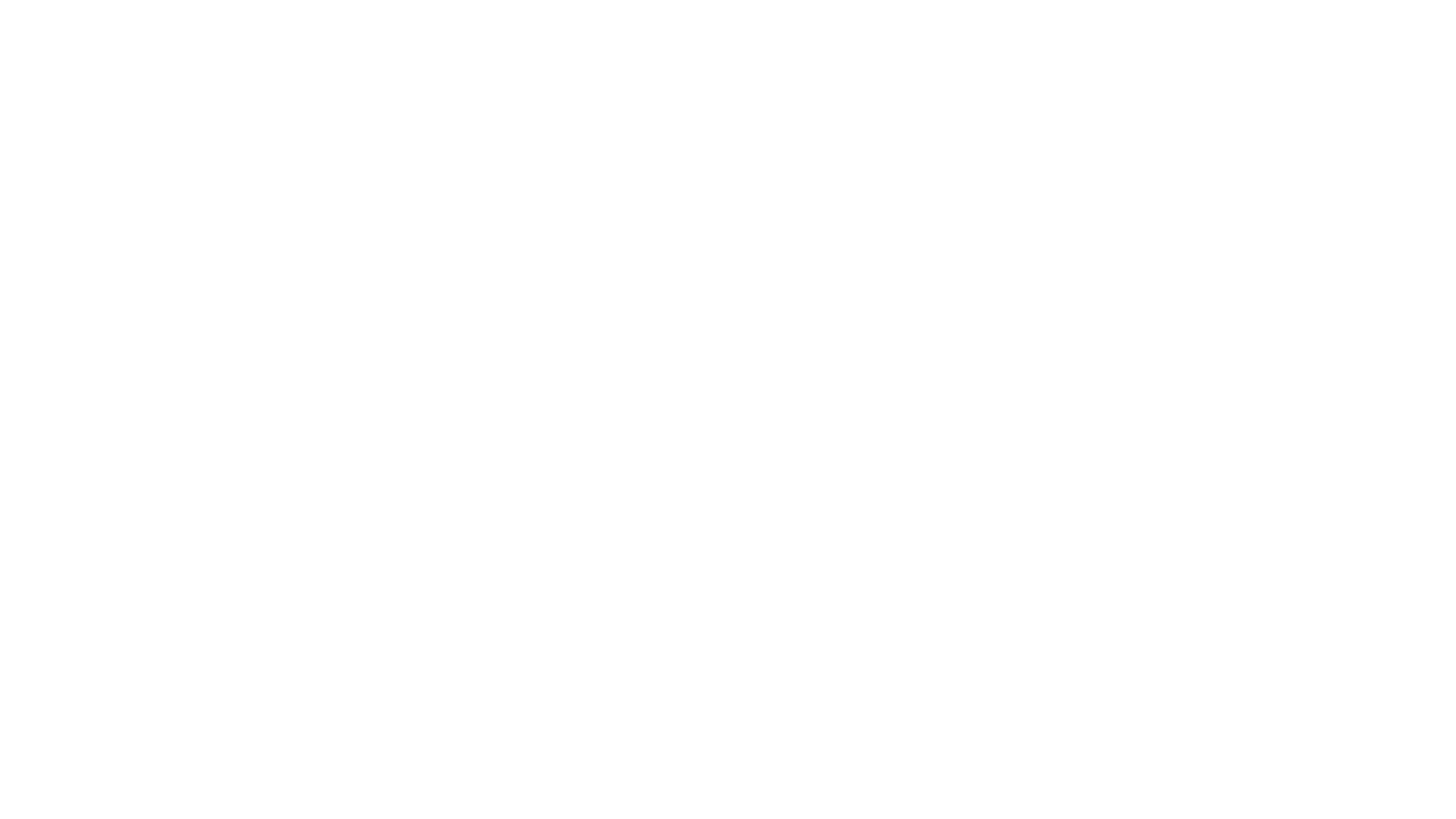
Aquakulturinfo - Das Informationsportal zur Aquakultur des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei
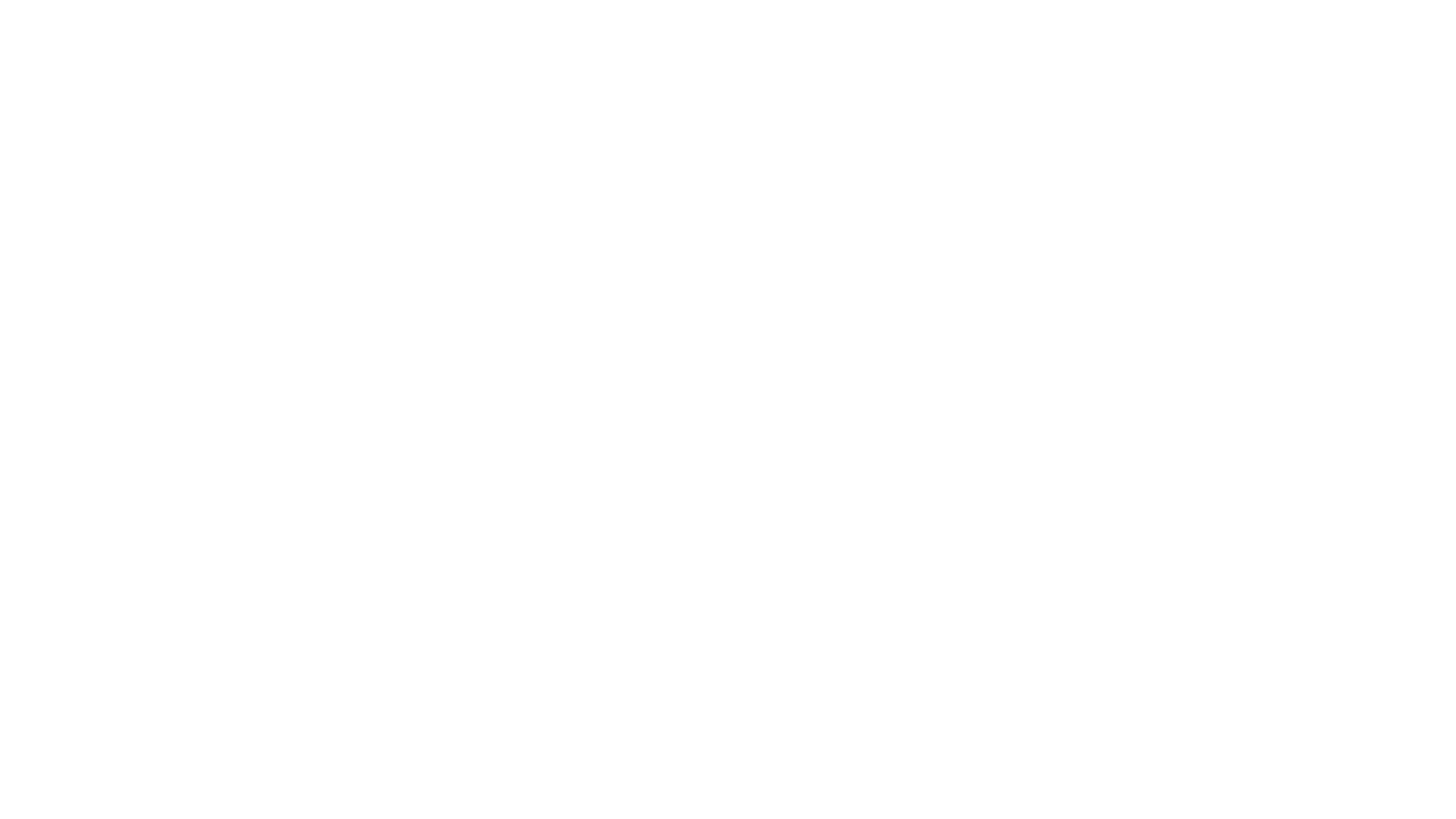
Copa Cogeca (General Confederation of Agricultural Cooperatives) vertritt die Interessen der Agrar-, Forst- und Fischereigenossenschaften bei der Entscheidungsfindung auf EU-Ebene.
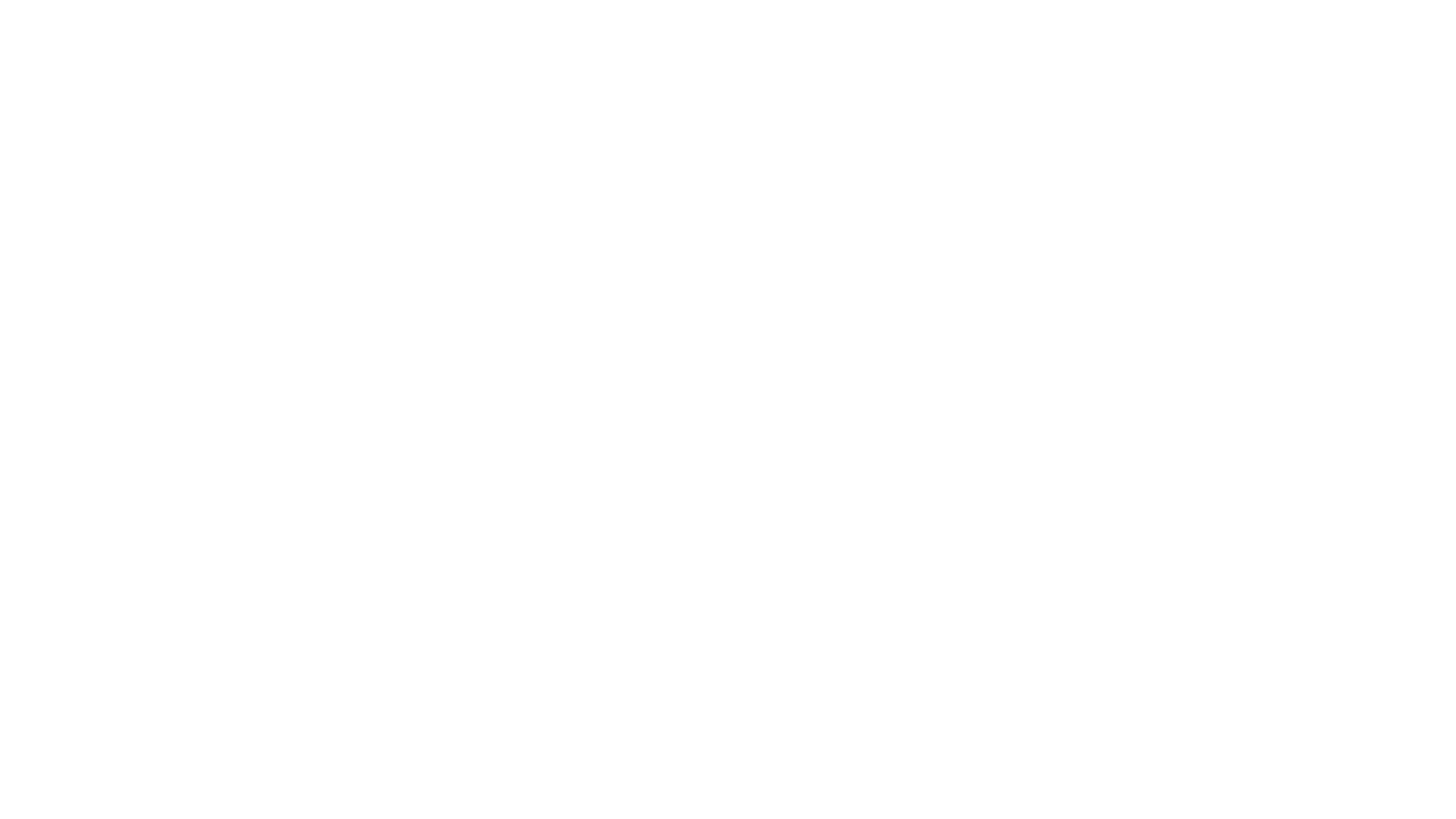
AAC (Aquaculture Advisory Council) berät die Europäische Kommission und die Mitgliedsstaaten in allen Rechtsfragen rund um Fischerei und Aquakultur.
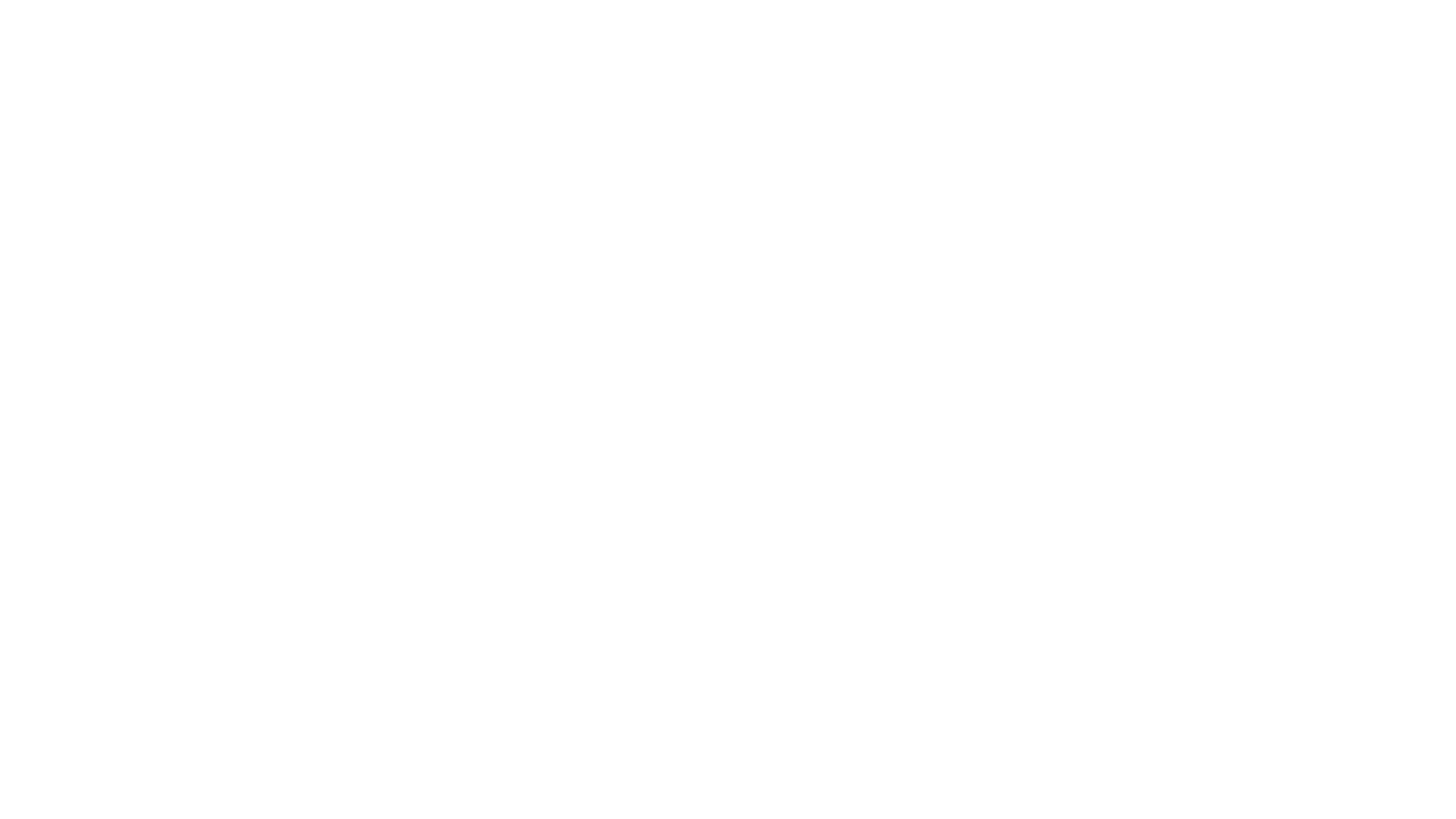
FEAP (Federation of European Aquaculture Producers) ist die Stimme der professionellen Fischerei und Aquakultur in Europa.
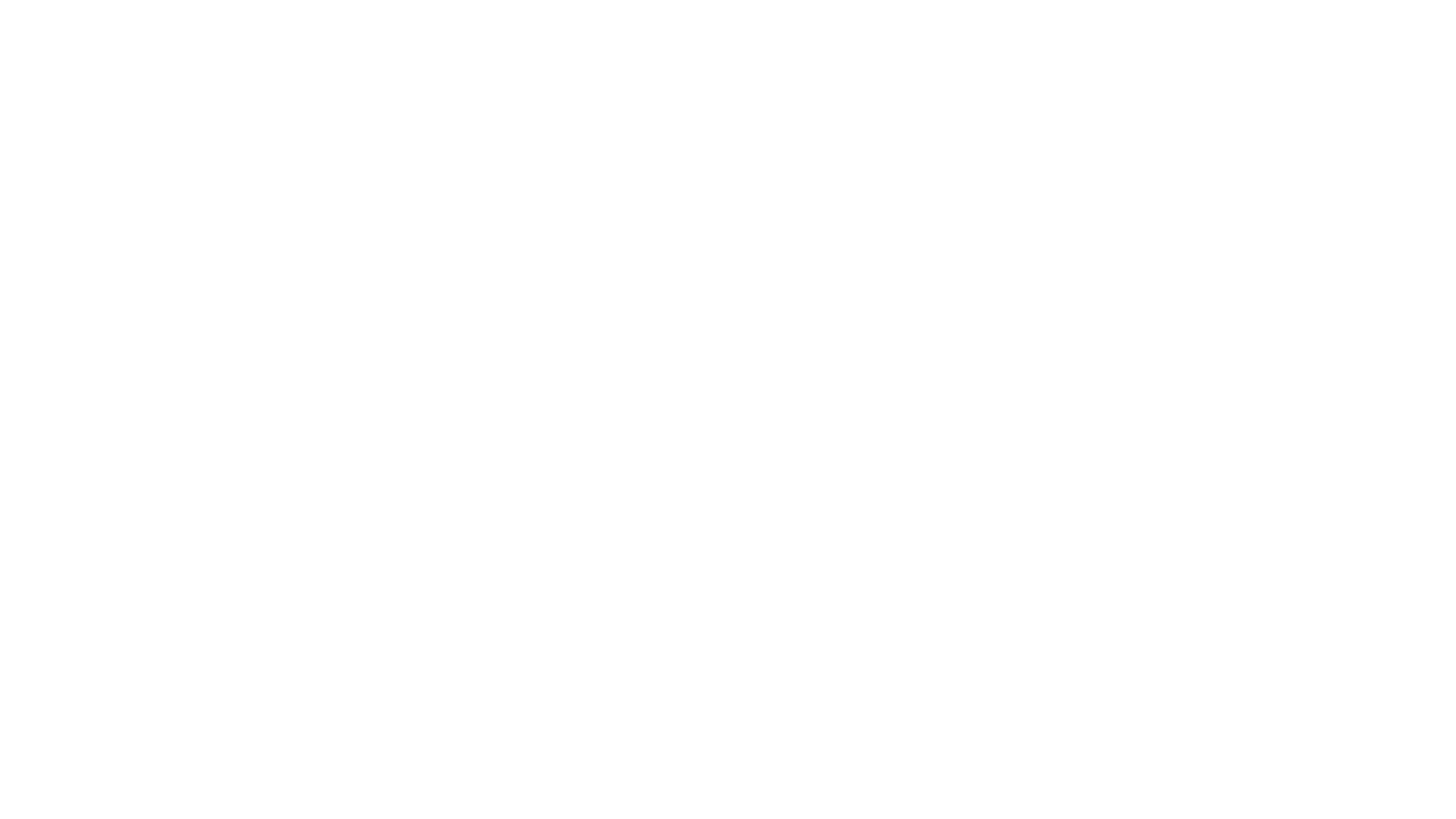
Im Mittelpunkt der Arbeiten des FLI stehen die Gesundheit und das Wohlbefinden landwirtschaftlicher Nutztiere und der Schutz des Menschen vor Zoonosen, d. h. zwischen Tier und Mensch übertragbaren Infektionen.
Young fishermen
2020 war alles anders. 2020 haben sich viele (gezwungene) Veränderungen und Innovationen ergeben. Dazu zählt im Fischereibereich die Gründung der Young Fishermen (YFM). Als Arbeitsgruppe im Verband der Deutschen Binnenfischerei und Aquakultur (VDBA) stehen sie in den Startlöchern, um ihre Zukunft in der Fischzucht & Fischerei selbst mitzugestalten.




Der Verband gliedert sich in folgende Sparten, vertreten durch:
Präsidium
Präsident: Bernhard Feneis
Vizepräsident: Peter Grimm und Ronald Menzel
Weiterhin:
Stefan Hofer
Sabine Schwarten
Torben Heese
Vizepräsident: Peter Grimm und Ronald Menzel
Weiterhin:
Stefan Hofer
Sabine Schwarten
Torben Heese
Forellenzucht
Spartenleiter: Peter Grimm
Stellvertreter: Stephan Hofer
weitere Mitglieder:
Elmar Mohnen
Markus Lichtenecker
Torsten Uhthoff
Alexander Tautenhahn
Stellvertreter: Stephan Hofer
weitere Mitglieder:
Elmar Mohnen
Markus Lichtenecker
Torsten Uhthoff
Alexander Tautenhahn
Karpfenteichwirtschaft
Spartenleiter: Bernhard Feneis
Stellvertreter: Torben Heese
weitere Mitglieder:
Gerd Michaelis
Gunnar Reese
Alfred Stier
Stellvertreter: Torben Heese
weitere Mitglieder:
Gerd Michaelis
Gunnar Reese
Alfred Stier
Fluss- und Seenfischerei
Spartenleiter: Ronald Menzel
Stellvertreterin: Sabine Schwarten
weitere Mitglieder:
Carsten Brauer
Florian Lex
Martin Bork
Martin Boesenecker
Stellvertreterin: Sabine Schwarten
weitere Mitglieder:
Carsten Brauer
Florian Lex
Martin Bork
Martin Boesenecker
Spartenleiterin: Anna Klupp
Stellvertreterin: Isabel Schwegel
Weiterhin:
Karl Bissa
Gero Weinhardt
Martin Weierich
Stellvertreterin: Isabel Schwegel
Weiterhin:
Karl Bissa
Gero Weinhardt
Martin Weierich
